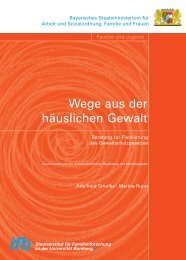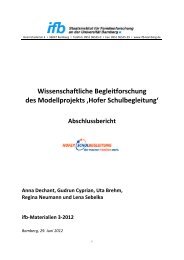ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Väterdilemma: Die Balance zwischen Anfor<strong>der</strong>ungen im Beruf und Engagement in <strong>der</strong> <strong>Familie</strong><br />
148<br />
son<strong>der</strong>n eher über Sportvereine o<strong>der</strong> Bürgerzentren. Beim Herstellen von Leichtwinddrachen<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> akkuraten Feinarbeit am Holzbumerang sollen Väter ihren persönlichen Stil entfalten.<br />
„Einfach leben. Wald, <strong>Lage</strong>rfeuer, weg von <strong>der</strong> Berieselungskiste“, heißt es in einer Ausschreibung.<br />
Vater-Kind-Freizeiten, die ein Wochenende o<strong>der</strong> auch eine ganze Woche dauern können,<br />
sind häufig gut gebucht. Solche Aktivitäten ermöglichen gemeinsame Erlebnisse und geben<br />
Männern die Möglichkeit, das Zusammensein mit ihren Kin<strong>der</strong>n mit eigenen Interessen zu verbinden.<br />
Die Chancen für Frauen, sich in <strong>der</strong> Arbeitswelt zu behaupten, haben sich erheblich verbessert.<br />
So wie sich Mütter ein „feminisiertes“ Klima im Beruf wünschen, so brauchen Väter ein stärker<br />
von männlichen Werten geprägtes Leben mit Kin<strong>der</strong>n. Bildungsarbeit kann dazu mit unterstützenden<br />
Angeboten einen Beitrag leisten.<br />
5.6 Zeitpioniere und Dinosaurier – Betriebliche Hürden<br />
für engagierte Vaterschaft<br />
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Männer, die das Aufwachsen ihrer Kin<strong>der</strong> miterleben und sich dafür Zeit nehmen wollen, sehen<br />
sich am Arbeitsplatz mit massiven betrieblichen Hin<strong>der</strong>nissen konfrontiert. „Männer haben ein<br />
Interesse an aktiver Vaterschaft, die sie zum Teil auch unter Inkaufnahme beruflicher Risiken einlösen“<br />
(Grottian, Kassner und Rüling 2003). Es bereitet häufig große Schwierigkeiten, Elternzeito<strong>der</strong><br />
Teilzeitwünsche tatsächlich zu realisieren. „Die höheren Hierarchieebenen werden von traditionellen<br />
Wertvorstellungen beherrscht“, stellt eine Studie fest, die das Thema „Männer zwischen<br />
<strong>Familie</strong> und Beruf“ aus betriebswirtschaftlicher Perspektive als „Anwendungsfall für die<br />
Individualisierung <strong>der</strong> Personalpolitik“ untersucht hat (Peinelt-Jordan 1996, S. 129).<br />
Der gesellschaftliche Druck, konform mit traditionellen Rollen zu leben, ist nach wie vor enorm.<br />
Es braucht viel Selbstbewusstsein, in einer männlich geprägten Arbeitskultur abweichendes<br />
Verhalten zu zeigen. Wer nicht richtig funktioniert und auch mal demonstrativ früher geht, gilt<br />
schnell als Außenseiter. Viele Väter scheuen die Risiken, die damit verbunden sind, im Unternehmen<br />
eine ausgeprägte private Orientierung offen zu vertreten. Die meisten Vorgesetzten<br />
messen Leistung immer noch an betrieblicher Präsenz und weniger an Ergebnissen. „Karrieren<br />
werden nach 17 Uhr entschieden“ bekommt zu hören, wer genau um diese Zeit endlich gehen<br />
will. Im Kern geht es dabei weniger um Betriebswirtschaft als um Psychologie: Die Unternehmensleiter<br />
betrachten es fast als erzieherische Aufgabe, ihre Erwerbsorientierung als Kern persönlicher<br />
Identität an die jüngere Generation weiterzugeben (Schnack/Gesterkamp 1998, S. 202 ff.)<br />
Wer sich seinen Posten durch lange Arbeitszeiten mühsam erkämpft hat, stellt auch hohe Ansprüche<br />
an die Anwesenheitsdisziplin seiner Untergebenen. Überstunden gelten als Zeichen<br />
von Unentbehrlichkeit, Loyalität und Identifikation mit dem Unternehmen (Dellekönig 1995). Die<br />
Appelle, männliche Arbeitnehmer auf freiwilliger Basis von geringeren Arbeitszeiten (bei entsprechend<br />
niedriger Entlohnung) zu überzeugen, haben bisher wenig gefruchtet. Nahezu unverän<strong>der</strong>t<br />
gilt die Feststellung: „Es sind vor allem jüngere, im tertiären Sektor und im öffentlichen<br />
Dienst beschäftigte Männer mit relativ hohem Bildungsstand, die zu einer Abkehr von <strong>der</strong> traditionellen<br />
männlichen Berufszentriertheit bereit sind“ (Prenzel 1990, S. 106).<br />
Als Vertreter einer „Gleichgewichtsethik“ charakterisierte die Berliner Untersuchung die freiwilligen<br />
Teilzeit-Männer: Es handelt sich um „Leute, für die materielle Bestrebungen wie ‘Beruflichen<br />
Erfolg haben’, ‘Ein eigenes Haus haben’, ‘Sich etwas leisten können’ fast ohne Bedeutung<br />
sind“ (ebd., S. 107). Diese hedonistische Haltung stößt auf Hin<strong>der</strong>nisse und Ressentiments.