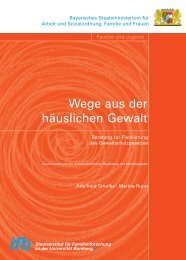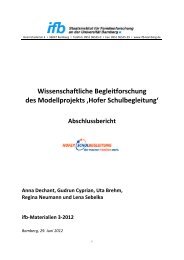ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Jugendlichen ist ein gegenteiliger Effekt nachgewiesen – hier entwickeln diejenigen Kin<strong>der</strong>,<br />
<strong>der</strong>en Väter stärker präsent sind, mehr Verhaltensprobleme als Kin<strong>der</strong>, <strong>der</strong>en Väter weniger<br />
engagiert sind (zusfd. s. Dunn 2004). Flouri (2005) zeigt, dass ein hohes väterliches Engagement<br />
zumindest schwere Probleme <strong>der</strong> Jugendlichen mit Gleichaltrigen reduziert.<br />
Die insgesamt eher geringe Bedeutung <strong>der</strong> Kontakthäufigkeit und des Engagements getrennt<br />
leben<strong>der</strong> Väter für die kindliche Entwicklung wird auf folgende Gründe zurückgeführt:<br />
• Beziehungsqualität<br />
Geeignete Indikatoren für die Bereitstellung entwicklungsför<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Erfahrungen sind nicht<br />
die von außen beobachteten Merkmale des Kontakts, son<strong>der</strong>n die Art und Weise, wie sich die<br />
Beziehung des Vaters aus <strong>der</strong> Sicht des Kindes darstellt. Diese Annahme gilt mittlerweile als<br />
gut gesichert (zusammenfassend s. Amato 2004; Dunn et al. 2004). Dabei ist zu beachten,<br />
dass sich die Beziehungsqualität zwischen Vater und Kind bereits vor <strong>der</strong> Trennung <strong>der</strong> Eltern<br />
formt (Sprujit et al. 2004): Kin<strong>der</strong>, die ihre Beziehung zum Vater vor <strong>der</strong> Trennung positiv beschreiben,<br />
nehmen diese auch nach <strong>der</strong> Trennung positiver wahr. Kin<strong>der</strong>, die ihre Beziehung<br />
zum getrennt lebenden Vater positiv bewerten, entwickeln deutlich weniger Verhaltensprobleme<br />
und gesundheitliche Einbußen. Die positiven gesundheitlichen Auswirkungen einer<br />
hohen Beziehungsqualität lassen sich bis ins Erwachsenenalter hinein nachweisen<br />
(Amato/Sobolewski 2004). Zudem för<strong>der</strong>t ein gutes Verhältnis zum getrennt lebenden Vater<br />
die kognitive und psychosoziale Entwicklung (Flouri 2005, Dunn et al. 2004). Bei Kin<strong>der</strong>n, die<br />
eine belastete Beziehung zum getrennt lebenden Elternteil haben, ist häufig auch das Verhältnis<br />
zum allein erziehenden Elternteil problematisch. Mit dieser Konstellation verbinden sich<br />
beson<strong>der</strong>s hohe Entwicklungsrisiken (Dunn et al. 2004).<br />
• Konfliktniveau <strong>der</strong> getrennt lebenden Eltern<br />
Konsens besteht darüber, dass die Auswirkungen des Kontakts zum Vater und die Beziehungsqualität<br />
zwischen dem getrennt lebenden Vater und dem Kind entscheidend durch das Konfliktniveau<br />
zwischen den getrennt lebenden Eltern beeinflusst werden. Ist <strong>der</strong> Konflikt zwischen<br />
den Eltern auch nach <strong>der</strong> Trennung hoch, geht dies mit erheblichen Loyalitätskonflikten und<br />
einem erhöhten Belastungserleben <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> einher. In dieser Konstellation verschärft ein<br />
häufiger Kontakt des Kindes zum Vater die negativen Folgen für die kindliche Entwicklung 73 .<br />
Ist das elterliche Konfliktniveau gering, sind positive Auswirkungen einer hohen Kontaktfrequenz<br />
belegt (zusfd. s. Amato/Sobolewski 2004). Der allein erziehenden Mutter sowie <strong>der</strong>en<br />
Herkunftsfamilie kommt eine wichtige Steuerungsfunktion zu – ihre Bewertung des Verhaltens<br />
des getrennt lebenden Vaters kann entscheidend dazu beitragen, dass bestehende Konflikte<br />
nach <strong>der</strong> Trennung entschärft werden o<strong>der</strong> eskalieren (Doherty et al. 1998).<br />
• Art <strong>der</strong> Interaktionsangebote<br />
Neuere Studien widmen sich zunehmend <strong>der</strong> Frage wie getrennt lebende Väter, die gemeinsame<br />
Zeit mit ihren Kin<strong>der</strong>n gestalten und welche Folgen mit unterschiedlichen Formen <strong>der</strong><br />
Interaktion verbunden sind. Allein erziehende Mütter entwickeln häufig einen permissiven<br />
Erziehungsstil, <strong>der</strong> sich u. a. durch ein wenig for<strong>der</strong>ndes und gewährendes Verhalten auszeichnet<br />
(zusammenfassend s. Limmer 2004). Vorliegende Ergebnisse zum Erziehungsverhalten<br />
<strong>der</strong> getrennt lebenden Väter weisen in eine ähnliche Richtung: Die meisten Väter bieten<br />
ihren Kin<strong>der</strong>n primär auf Freizeit und Unterhaltung ausgelegte Aktivitäten. Für diese Form<br />
<strong>der</strong> Interaktionsgestaltung sind in den vorliegenden Studien keinerlei positive Auswirkungen<br />
auf die kindliche Entwicklung belegt. Bemerkenswerterweise erleben auch die Väter diese<br />
73 Eine Studie belegt, dass nach Trennung/Scheidung diejenigen Kin<strong>der</strong> das höchste Ausmaß an Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, <strong>der</strong>en<br />
Mütter die hohe Kontaktfrequenz zum Vater als Problem bewerteten (King/Heard 1999).<br />
Wenn <strong>der</strong> Vater im Alltag fehlt<br />
101