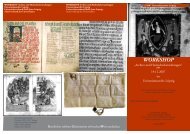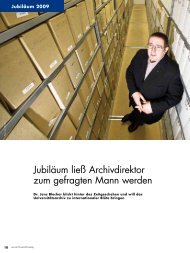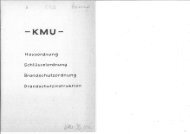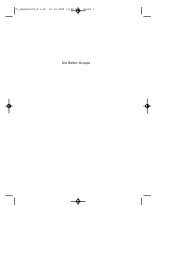Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Mein <strong>Leipzig</strong> lob’ ich mir“, so pries der Dichter Johann Wolfgang Goethe<br />
(1749 – 1832) seinen Studienort, und dass die <strong>Leipzig</strong>er Jahre zu seinen schönsten<br />
und erfolgreichsten gehört haben, bekannte gleichfalls der gebürtige <strong>Leipzig</strong>er<br />
Mathematiker Erich Kähler.<br />
Geboren ist Kähler in <strong>Leipzig</strong> als Sohn eines Telegrapheninspektors, und er hat<br />
die Schule und danach ein Mathematikstudium in seiner Heimatstadt absolviert.<br />
Dabei hat er dank verständiger Lehrer in den letzten Jahren der Oberrealschule<br />
gar nicht mehr am Mathematikunterricht teilgenommen, sondern die ihm vom<br />
Schuldirektor überlassenen Mitschriften Weierstraßscher Mathematikvorlesungen<br />
durchgearbeitet, sodass der Abiturient bereits bestens mit elliptischen und<br />
abelschen Funktionen vertraut war, die seinerzeit noch ein wesentliches mathematisches<br />
Forschungsgebiet ausmachten. Schließlich verfasste der 17-Jährige<br />
eine etwa 50-seitige Abhandlung, die er dem <strong>Leipzig</strong>er Professor Otto Hölder<br />
(1859 – 1937) vorlegte, um damit promoviert zu werden. Kähler wurde darauf<br />
hingewiesen, dass dazu ein Mathematikstudium erforderlich sei, und er studierte<br />
daraufhin sechs Semester in <strong>Leipzig</strong>, insbesondere bei Leon Lichtenstein<br />
(1878 – 1933) und konnte dann 1928 mit dem selbst gestellten Thema „Über die<br />
Existenz von Gleichgewichtsfiguren“ aus der Himmelsmechanik promovieren.<br />
Ein Stipendium der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ermöglichte<br />
ihm zunächst weitere wissenschaftliche Arbeit.<br />
Auf dem Weg in den Urlaub führte er an der <strong>Universität</strong> Hamburg ein folgenreiches<br />
Gespräch mit Emil Artin (1898 – 1962), das in Hamburg zu einer<br />
Assistentenstelle bei Wilhelm Blaschke (1885 – 1962) führte. Bereits 1930<br />
habilitierte sich Kähler mit der Arbeit „Über die Integrale algebraischer Differentialgleichungen“<br />
und wurde Privatdozent in Hamburg, eine Stellung, die er<br />
bis 1935 beibehielt und nur durch einen einjährigen Studienaufenthalt als Rockefellerstipendiat<br />
in Rom (1931 – 1932) unterbrach. In Rom lernte Kähler die<br />
führenden italienischen algebraischen Geometer kennen, aber auch André Weil<br />
(1906 – 1998), mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte.<br />
Blaschke hatte versucht, dem begabten jungen Mathematiker eine Professur zu<br />
verschaffen, wobei ihm im Hinblick auf weitere Kontakte Rostock der geographischen<br />
Nähe wegen besonders geeignet erschien. Aber Kähler war die außerordentlich<br />
anregende Hamburger Atmosphäre, die durch Mathematiker wie Emil<br />
Artin, Wilhelm Blaschke und Erich Hecke (1887 – 1947) sowie durch den Physiker<br />
Wilhelm Lenz (1888 – 1957) und die späteren Nobelpreisträger für Physik<br />
Wolfgang Pauli (1900 – 1958), Otto Stern (1888 – 1969) und Johannes Jensen<br />
(1907 – 1973) geprägt wurde, wichtiger als eine schnelle berufliche Karriere.<br />
10