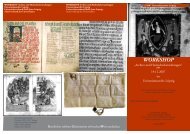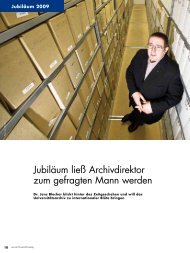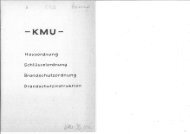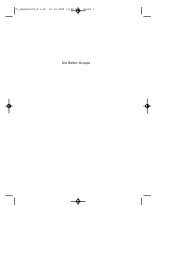Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Im Jahre 1894 erhielt das Physikalische Institut der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, in dem<br />
man sich vorrangig mit dem physikalischen Experiment als Grundlage des Faches<br />
befasste, eine Abteilung für theoretische Physik, die das Experiment mathematisch<br />
formulierte, ehe es erprobt wurde. 35 Jahre später erlangte sie – inzwischen<br />
ein selbstständiges Institut – Weltgeltung durch die Entwicklung<br />
der Quantenmechanik und ihre Anwendung auf die Struktur der Materie, die<br />
mit der Berufung Werner Heisenbergs auf den <strong>Leipzig</strong>er Lehrstuhl für theoretische<br />
Physik verbunden war.<br />
Bereits im Februar 1894 hatte die Philosophische Fakultät dem Kultusministerium<br />
dargelegt, „wie wichtig die Errichtung einer außerordentlichen Professur<br />
der theoretischen Physik für die Ausbildung der Studierenden der Physik“ sei.<br />
Das Ministerium schloss sich dieser Meinung an und berief Hermann Ebert,<br />
der aber nach nur wenigen Monaten einem Ruf an die Tierärztliche Hochschule<br />
in Hannover folgte.<br />
Über dem „Goldenen Zeitalter der Atomphysik“, wie Heisenberg die ersten<br />
Jahre seiner <strong>Leipzig</strong>er Tätigkeit genannt hat, kann jener hochbegabte Physiker<br />
in Vergessenheit geraten, mit dem das <strong>Leipzig</strong>er theoretisch-physikalische Institut<br />
eigentlich seinen Anfang nahm, Paul Drude. Er lehrte theoretische Physik<br />
vom Wintersemester 1894 an bis zu seinem Weggang nach Gießen im Jahre<br />
1900. Dem damaligen Rang seiner Abteilung gemäß, hatte er nur eine außerordentliche<br />
Professur inne und gehörte der Königlich Sächsischen Gesellschaft<br />
der Wissenschaften nur als außerordentliches Mitglied an, was besagt, dass er<br />
in der mathematisch-physischen Klasse zwar Vorträge halten und sie in den<br />
Akademieschriften publizieren durfte, bei Wahlen aber nicht stimmberechtigt<br />
war. Er stand in <strong>Leipzig</strong> immer im zweiten Glied und musste dem Aufstieg<br />
anderer zusehen, ohne selbst aufzurücken – ein Opfer der Prinzipienreiterei des<br />
damaligen Sächsischen Kultusministers, der jede Beförderung am Ort ablehnte<br />
und damit die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> einer hervorragenden Kraft beraubte.<br />
1900 wurde Drude ordentlicher Professor der Physik in Gießen, 1905 ging er als<br />
Nachfolger von Hermann Helmholtz, August Kundt und Emil Warburg nach Berlin.<br />
Diesen Vorbildern wollte er nachstreben und sich an ihnen messen lassen.<br />
Am 28. Juni 1906 hielt er nach seiner Wahl zum ordentlichen Mitglied vor der<br />
Berliner Akademie seine Antrittsrede, dankbar für die Ehre und voller Zuversicht<br />
im Blick auf künftige wissenschaftliche Pläne, aber auch in Sorge, „dass<br />
die eigene Fähigkeit und Arbeitskraft“ nicht ausreichen könnte für die gestellten<br />
Aufgaben. Am 5. Juli 1906 setzte er, 43-jährig, seinem Leben ein Ende. Sein<br />
Tod erschütterte die gesamte physikalische Welt. Die ausführlichste und ergrei-<br />
90