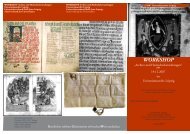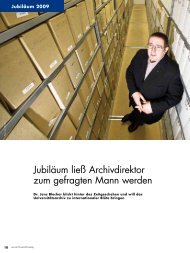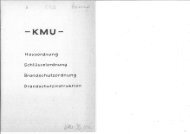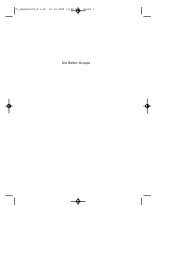Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mit diesem System der Abstufungen und Mindestvoraussetzungen passen die<br />
Aufzeichnungen über die ersten Promotionen in den höheren Fakultäten gut<br />
zusammen. Erst zum Ende der 1420er Jahre dürften die ersten Bewerber von<br />
der Qualifizierung her im Stande gewesen sein, um eines der Doktorate nachzusuchen.<br />
Tatsächlich erfolgen Aufzeichnungen über Doktorpromotionen an den<br />
höheren Fakultäten erst 22 Jahre nach der <strong>Universität</strong>sgründung: in der Medizin<br />
1431, in der Theologie 1432 (Lizentiat), und bei den Juristen sind Aufzeichnungen<br />
zwar vorhanden, aber erst nach 1479 datierbar.<br />
Bevor man aber Doktorhut und -tracht anlegen konnte, galt es noch eine zweite<br />
Hürde zu nehmen – mittelalterliche Graduierungen waren extrem kostspielig.<br />
Die Einnahmen, die die Fakultäten durch die Graduierungen erzielten, entstanden<br />
sowohl durch die Gebühren für den Besuch vorgeschriebener Lehrveranstaltungen<br />
als auch durch direkte Prüfungsgebühren und Sachleistungen. Überschlägt<br />
man die Einnahmen, die der <strong>Universität</strong> aus solchen Gebühren zuflossen,<br />
so zeigt sich, dass sie ein bedeutender Teil der mittelalterlichen <strong>Universität</strong>sfinanzen<br />
gewesen sind. Vergleicht man sie mit den Besoldungen der neun landesherrlichen<br />
Stiftungsprofessuren – dann hätten allein durch die Promotionsgebühren<br />
drei weitere Professorenstellen fest besoldet werden können. So ist es<br />
kein Wunder, dass die Verteilung dieser Gelder immer wieder Eifersüchteleien<br />
erzeugte. Bereits 1446 versuchten die 16 Magister in der Artistenfakultät, die im<br />
beschlussfassenden Consilium saßen, die anderen Magister von der Verteilung<br />
der Promotionsgebühren auszuschließen. Diese „Reform“ der Fakultätsordnung<br />
misslang jedoch. Rund 240 Jahre später, 1685, sorgte der Landesherr dann selbst<br />
für die entsprechende Änderung. Statt der bisherigen Verwaltung der Fakultätsgeschäfte<br />
durch gewählte Magister aus den 4 Nationen waren von nun an nur<br />
noch die 9 Professuren alter Stiftung dazu berechtigt. Am Ende des 18. Jahrhunderts<br />
werden nur noch die Professoren alter Stiftung als empfangsberechtigte<br />
Fakultätsmitglieder betrachtet.<br />
Nach der Reformation kamen auf zukünftige Doktoren noch weitere Auslagen<br />
zu. Mit dem weltlichen Lebensstand der meisten Fakultätsangehörigen wurden<br />
Kosten für die Haushaltsführung der Familienangehörigen fällig. Besonders mit<br />
Bezug auf die Juristen wird berichtet (in der Festschrift von 1909), dass zwar<br />
die Ausgaben der Doktoren für Luxus und Prunk nicht überdurchschnittlich waren<br />
– für ihre weiblichen Familienangehörigen habe das aber nicht im gleichen<br />
Maße zugetroffen: „Selbst die Beschränkungen, welche die Kleiderordnung von<br />
1612 den Doktorenfrauen und -töchtern auferlegte, sind doch immer noch derart,<br />
daß sie heute als unerhörter Aufwand gebrandmarkt werden würden, und wenn<br />
eine Doktorenfrau, der Damastkleider und Sammetschürzen gar nicht zu geden-<br />
179