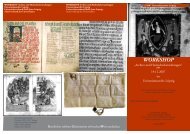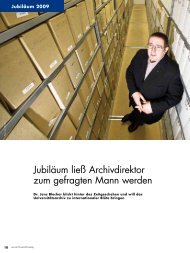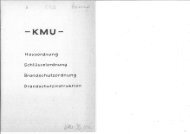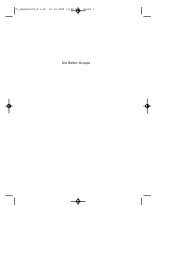Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
Was mit ihm, abgesehen von allem persönlichen Verluste, überhaupt verloren<br />
gegangen ist, ob nicht in ihm der letzte große Philologe zu Grabe<br />
getragen wurde – das weiß ich nicht mit Sicherheit zu beantworten. Aber<br />
ob die Antwort so oder ganz anders ausfalle – daß in seinen Schülern eine<br />
nie erhörte Fruchtbarkeit seiner Wissenschaft verbürgt sei –, jede Antwort<br />
fällt zu seiner Ehre aus: es ist ein gleich großer Ruhm, der letzte der<br />
Großen oder der Vater einer ganzen großen Periode zu heißen.<br />
Mit diesen Worten gedenkt Friedrich Nietzsche seines am 9. November 1876 in<br />
<strong>Leipzig</strong> verstorbenen Lehrers Friedrich Ritschl in einem Brief an dessen Witwe<br />
Sophie vom Januar 1877.<br />
Geboren wurde Friedrich Ritschl am 6. April 1806 im thüringischen Groß-Vargula<br />
bei Erfurt als Sohn eines Pfarrers. Er studierte Philologie in <strong>Leipzig</strong> bei<br />
Gottfried Hermann und in Halle bei Karl Christian Reisig, wo er sich 1829 als<br />
Vierundzwanzigjähriger habilitierte und 1832 zum Extraordinarius ernannt wurde.<br />
1833 folgte er einem Ruf an die <strong>Universität</strong> Breslau. Dort heiratete er 1838<br />
Sophie Guttentag; die beiden hatten zwei Töchter und einen Sohn. Im Jahr 1839<br />
wechselte Ritschl an die <strong>Universität</strong> Bonn, wo er bis 1865 als Ordinarius wirkte.<br />
Nach Konflikten mit seinem dortigen Kollegen Otto Jahn folgte er 1865 einem<br />
Ruf nach <strong>Leipzig</strong>. Dort lehrte Ritschl bis zu seinem Tod am 9. November 1876.<br />
Obwohl Ritschls wissenschaftlicher Ruhm vor allem auf seinen Forschungen<br />
in der lateinischen Philologie, insbesondere zu Plautus und zum Altlateinischen<br />
beruht, sind seine frühesten wissenschaftlichen Arbeiten dem Griechischen gewidmet:<br />
Bis heute nicht ersetzt ist Ritschls Ausgabe der Ecloga vocum Atticarum<br />
des Thomas Magister (Halle 1832), eines attizistischen Lexikons aus dem frühen<br />
14. Jahrhundert. 1838 erschien dann in Breslau seine Arbeit über „Die Alexandrinischen<br />
Bibliotheken und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch<br />
Pisistratus“, die Karl Lehrs, einer der besten Kenner der antiken Homerphilologie<br />
im 19. Jahrhundert, als „goldenes Büchlein“ gepriesen hat. Ausgangspunkt<br />
ist ein neues Zeugnis zur antiken Philologiegeschichte, welches Ritschl in dieser<br />
Arbeit erstmals vollständig aus einer römischen Handschrift mitteilte und welches<br />
ihn veranlasste, auf die Geschichte der Bibliothek von Alexandria und das<br />
Zustandekommen des Homertextes einzugehen.<br />
Seit der Bonner Zeit steht jedoch der altlateinische Komödiendichter Plautus<br />
(ca. 250 – 180 v. Chr.) im Zentrum von Ritschls wissenschaftlichem Schaffen.<br />
Den entscheidenden Impuls zu einer lebenslangen Beschäftigung mit diesem<br />
Dichter hatte eine Italienreise in den Jahren 1836 bis 1837 gegeben: In Mailand