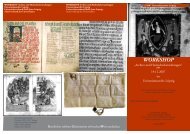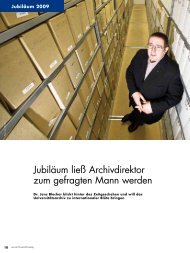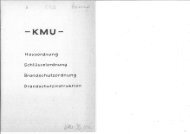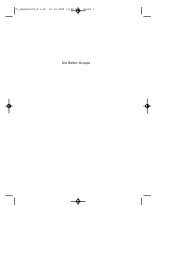Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Heidelberg vertiefte Schumanns Überzeugung, die Musik zum Beruf zu wählen,<br />
zurück in <strong>Leipzig</strong> setzte er den Unterricht bei dem bekannten Lehrer Friedrich<br />
Wieck fort, der mit dem Lehrerfolg an seiner Tochter Clara zu überzeugen wusste.<br />
Bereits mit 9 Jahren gab Clara Wieck unter Anleitung ihres Vaters öffentliche<br />
Konzerte (1828) und unternahm seit 1831/1832 erfolgreich Konzertreisen durch<br />
ganz Europa. Friedrich Wieck schien der rechte Lehrer, auch Robert Schumann<br />
zum Klaviervirtuosen heranzubilden. Endlich gab die Mutter ihre Einwilligung,<br />
aber obwohl Robert sogar in das Haus seines Lehrers einzog und sich ernsthaft<br />
den Übungen unterwarf, wurde der pianistische Durchbruch nicht erreicht. Vor<br />
allem blieb Robert hinter den Fähigkeiten der neun Jahre jüngeren Clara zurück,<br />
die pianistische Aufgaben schneller und leichter bewältigte als Robert. Mit Fingerdehnungsapparaten<br />
suchte Robert den Erfolg zu erzwingen, aber er zog sich<br />
eine »Erlahmung« der rechten Hand zu, die sich seit Oktober 1831 bemerkbar<br />
und seine Absicht von einer Virtuosenkarriere zunichte machte. Nun warf er sich<br />
mit Macht auf das Komponieren, das er bislang zwar breit in allen Gattungen,<br />
aber eher nebenher, halbherzig betrieben hatte, und komponierte eine Symphonie<br />
g-Moll, auch »Jugendsymphonie« oder »Zwickauer« genannt. Der erste Satz<br />
der Symphonie wurde tatsächlich aufgeführt, er erklang am 18. November 1832<br />
im Saal des Gewandhauses zu Zwickau, eine zweite und dritte Fassung am 12.<br />
oder 18. Februar 1833 in Schneeberg und am 29. April 1833 in <strong>Leipzig</strong>. Doch<br />
auch hier gelang kein Durchbruch, der mangelnde Erfolg und die Kritik, etwa<br />
auch Friedrich Wiecks Anmerkung, die Symphonie sei „zu mager instrumentiert“,<br />
ließ Schumann an seiner Bestimmung als Komponist zweifeln. Ernüchtert<br />
wandte er sich seit Mitte 1833 verstärkt der Aufgabe eines Musikschriftstellers<br />
zu und hatte endlich Erfolg: 1834 gründete er die „Neue Zeitschrift für Musik“,<br />
sie erscheint bis heute.<br />
Wenn Schumann in der folgenden Zeit komponierte, so offenbar nicht zufällig<br />
und mit Absicht vor allem für das Klavier (andere Kompositionspläne wurden<br />
nicht fertig). Die ersten 23 seiner mit Opuszahlen versehenen Werke sind ausschließlich<br />
Klavierwerke, erst mit op. 24, dem Liederkreis nach Heinrich Heine<br />
für eine Singstimme und Klavier, durchbrach er die Selbstbeschränkung. Nun<br />
aber mit Macht: Es war das Jahr 1840, das als Schumanns „Liederjahr“ berühmt<br />
wurde. Allein die Menge der Liedkompositionen ist beeindruckend. Es entstanden<br />
in diesem Jahr: op. 25 Myrthen (26 Lieder), op. 30 Drei Gedichte nach Emanuel<br />
Geibel, op. 31 Drei Gesänge nach Adelbert von Chamisso, op. 35 Zwölf Lieder<br />
(Justinus Kerner), op. 36 Sechs Gedichte aus Robert Reinicks »Lieder eines<br />
Malers«, op. 39 Liederkreis nach Joseph Freiherrn von Eichendorff, op. 40 Fünf<br />
Lieder (vier nach Hans Christian Andersen), op. 42 Frauenliebe und Leben (acht<br />
Lieder nach Adelbert von Chamisso), op. 45 und 49 Romanzen und Balladen für<br />
95