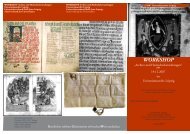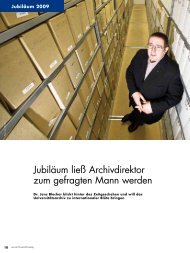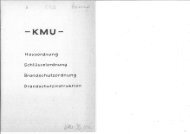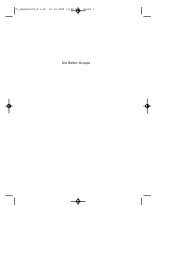Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Heinroth war von seiner ganzen Persönlichkeit her ein eminent stark vom<br />
protestantischen Christentum beeinflusster Mensch. Auch sein psychiatrisches<br />
Gesundheits- und Krankheitskonzept ist in hohem Maße davon geprägt. Die<br />
Ursache der Seelenstörungen – worunter er im engeren Sinne nur die endogenen<br />
Störungen begriff – sah er in einer vom Kranken selbst zu verantwortenden<br />
Schuld. Diese beruhe auf „Sünde“, darunter verstand er zum einen zwar auch im<br />
wortwörtlichen Sinne eine Abkehr von Gott, zum anderen vielmehr aber noch<br />
ein den christlich-ethischen Geboten widersprechendes Leben. Also sollte in<br />
seinem Sinne darunter ein insgesamt ‚falscher‘ Lebensstil des Menschen verstanden<br />
werden, nämlich wenn dessen Begierden überwiegend auf die Befriedigung<br />
irdischer Lebensbedürfnisse und Leidenschaften gerichtet seien. Gebe der<br />
Mensch diesen nach – und im Laufe der Zeit würden sie zwangsläufig stärker,<br />
bestimmender – führe dieser Befriedigungstrieb zur psychischen Krankheit.<br />
Grundsätzlich besitze der Mensch die Freiheit, sich für einen Lebensweg zu<br />
entscheiden, und damit letztendlich auch die Gewalt über die eigene Gesundheit<br />
oder Krankheit. Es wäre zu diskutieren, inwieweit für Heinroth bereits die auf<br />
die eigene Person gestützte Selbstverwirklichung eine Übertretung der christlichen<br />
Gebote darstellte.<br />
Diese Sünden- bzw. Eigenschuldtheorie legte Heinroth, zu dessen Oeuvre auch<br />
ein poetisches Schaffenswerk gehört und der vorübergehend auch mit Johann<br />
Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) in Kontakt stand, in zahlreichen, einem<br />
sehr romantisch-verschlungenen Duktus folgenden Büchern nieder. Das berühmteste<br />
dürfte das 1818 erschienene zweibändige ‚Lehrbuch der Störungen<br />
des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung‘ sein. Von<br />
Vertretern biologisch orientierter Konzepte wurde Heinroth im Nachhinein vorgeworfen,<br />
er habe die Entwicklung der Seelenheilkunde als medizinisches Fach<br />
behindert und sie in die Nähe mittelalterlich-neuzeitlicher Teufelsaustreibung<br />
geführt. In Wahrheit jedoch unterschied sich die von ihm theoretisch dargestellte<br />
„indirect-psychische Methode“ in keiner Weise von Therapieoptionen, die seine<br />
zeitgenössischen Kollegen in ihren Irrenanstalten viel ausgedehnter anwenden<br />
konnten und die uns erst in zunehmender Erkenntnis mit ihren mechanischen,<br />
pharmakologischen, Zwangs- oder mitunter sogar chirurgischen Erregungs- und<br />
Erschöpfungsmethoden martialisch und unwissenschaftlich anmuten. Heinroth<br />
propagiert sie immer erst als Mittel der zweiten Wahl. Und gerade sein vielschichtiger<br />
Begriff der ‚Person‘ weist weit über somatisch Beschränktes hinaus,<br />
auf heute moderne medizinische Denkhaltungen: „Die Person ist mehr als der<br />
bloße Körper, auch mehr als die bloße Seele: sie ist der ganze Mensch“. Insofern<br />
betont Heinroths Ansatz eben sehr wohl etwas Neues, Anderes, wenn er nämlich<br />
sein Augenmerk weniger auf die bloße Beseitigung von Krankheitssymptomen<br />
86