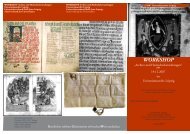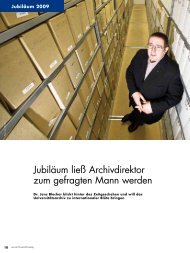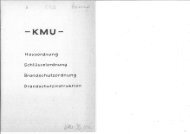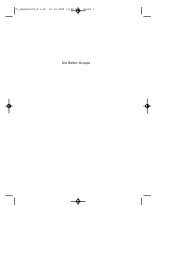Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Über die Jahrhunderte hinweg haben an der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> Persönlichkeiten<br />
gewirkt, die als Forschungsreisende zu Ruhm gelangten. Die Hochschule<br />
selbst hat allerdings kaum Anteil an diesen Unternehmungen genommen. Der<br />
Brasilienreisende Georg Marggraf, der Rußland- und Persienreisende Adam<br />
Olearius, der Südamerikaforscher Eduard Pöppig, der Afrikakenner Hans Meyer,<br />
um nur einige Beispiele aus dem 17. bis 20. Jahrhundert zu nennen, führten ihre<br />
Expeditionen durch, bevor sie Angehörige der Alma mater Lipsiensis wurden<br />
oder nachdem sie diese wieder verlassen hatten. Dagegen ist es hin und wieder<br />
zu Reisen gekommen, die von <strong>Leipzig</strong>er Gelehrten im Auftrag nichtuniversitärer<br />
Geldgeber organisiert und durchgeführt wurden. Man griff sozusagen auf die<br />
intellektuellen Kapazitäten zurück, die die Hochschule bot. So wurde beispielsweise<br />
Carl Chun, Professor der Zoologie, mit der Leitung der bedeutenden,<br />
vom Deutschen Reich finanzierten „Valdivia-Expedition“ zur Erforschung der<br />
Tiefsee (1898/99) beauftragt. Ein weit früheres Forschungsunternehmen dieses<br />
Charakters ist die sächsische Afrikaexpedition der Jahre 1731 bis 1733, deren<br />
Beginn sich <strong>2006</strong> zum 275. Male jährt.<br />
Der Anteil deutscher Forscher an der Erkundung Nord- und Zentralafrikas ist<br />
auffallend hoch. Es genügt der Hinweis auf Namen wie Heinrich Barth, Gustav<br />
Nachtigal, Gerhard Rohlfs und Eduard Vogel. Das sind freilich Namen des 19.<br />
Jahrhunderts, in dem in ganz Europa das Interesse an dem „dunklen Kontinent“<br />
stetig anwuchs. Im 18. Jahrhundert lag Afrika eher am Rand der geographischen<br />
Erschließung. Nordafrika galt im übrigen als Land der Barbareskenstaaten, deren<br />
Seeräubereien in ganz Europa gefürchtet wurden. Reisebeschreibungen dieser<br />
Gegenden mit wissenschaftlichem Gehalt sind aus jener Zeit daher selten. Eine<br />
Ausnahme bildet die von <strong>Leipzig</strong>er Wissenschaftlern durchgeführte Reise durch<br />
das Gebiet, das heute mit dem Namen Maghreb bezeichnet wird, damals aber unter<br />
der Bezeichnung „Barbarei“ bekannt war. Über den Ursprung der Idee, eine<br />
wissenschaftliche Reise nach Afrika durchzuführen, ist nichts Sicheres bekannt.<br />
Wahrscheinlich stammt sie vom Kurfürsten und König Friedrich August I. (II).<br />
selbst, der auf diesem Wege seine naturwissenschaftlichen Sammlungen erweitern<br />
und exotische Tiere für seine Menagerie direkt am Ort, in Afrika, erwerben<br />
wollte. Als Leiter einer solchen Expedition wurde ihm der junge Johann Ernst<br />
Hebenstreit empfohlen, der soeben in <strong>Leipzig</strong> zum Dr. med. promoviert worden<br />
war. Hebenstreit entwickelte alsbald ehrgeizige Ziele: Afrika sei der bisher am<br />
wenigsten erforschte Kontinent, der jedoch viele Reichtümer berge, deren Erkundung<br />
alle Mühen wert wäre. Vor allem die Tier- und Pflanzenwelt verspreche die<br />
mannigfachsten Entdekungen. Die Reiseinstruktion legte schließlich fest, dass<br />
die Expedition nach Afrika gehen solle, um dort für die „Cabinettes und Menagerie“<br />
des Fürsten „Thiere, Vögel, Kräuter, Blumen, Gewächse, Steine, nebst<br />
150