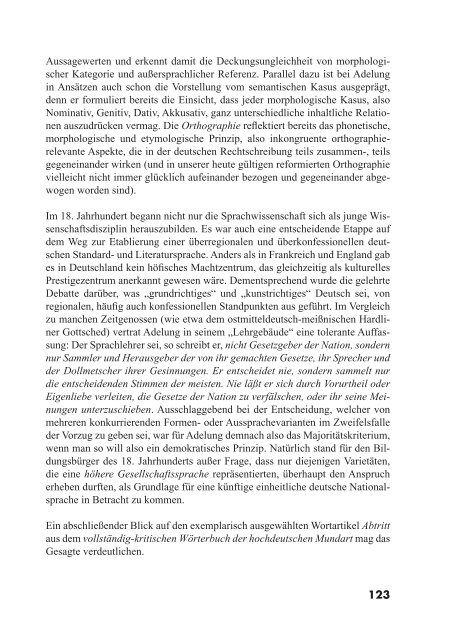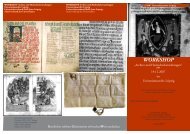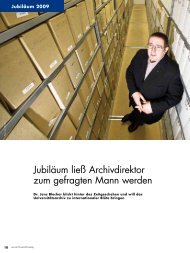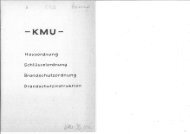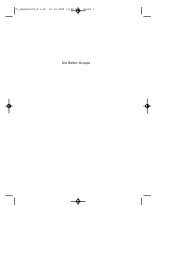Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aussagewerten und erkennt damit die Deckungsungleichheit von morphologischer<br />
Kategorie und außersprachlicher Referenz. Parallel dazu ist bei Adelung<br />
in Ansätzen auch schon die Vorstellung vom semantischen Kasus ausgeprägt,<br />
denn er formuliert bereits die Einsicht, dass jeder morphologische Kasus, also<br />
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, ganz unterschiedliche inhaltliche Relationen<br />
auszudrücken vermag. Die Orthographie reflektiert bereits das phonetische,<br />
morphologische und etymologische Prinzip, also inkongruente orthographierelevante<br />
Aspekte, die in der deutschen Rechtschreibung teils zusammen-, teils<br />
gegeneinander wirken (und in unserer heute gültigen reformierten Orthographie<br />
vielleicht nicht immer glücklich aufeinander bezogen und gegeneinander abgewogen<br />
worden sind).<br />
Im 18. Jahrhundert begann nicht nur die Sprachwissenschaft sich als junge Wissenschaftsdisziplin<br />
herauszubilden. Es war auch eine entscheidende Etappe auf<br />
dem Weg zur Etablierung einer überregionalen und überkonfessionellen deutschen<br />
Standard- und Literatursprache. Anders als in Frankreich und England gab<br />
es in Deutschland kein höfisches Machtzentrum, das gleichzeitig als kulturelles<br />
Prestigezentrum anerkannt gewesen wäre. Dementsprechend wurde die gelehrte<br />
Debatte darüber, was „grundrichtiges“ und „kunstrichtiges“ Deutsch sei, von<br />
regionalen, häufig auch konfessionellen Standpunkten aus geführt. Im Vergleich<br />
zu manchen Zeitgenossen (wie etwa dem ostmitteldeutsch-meißnischen Hardliner<br />
Gottsched) vertrat Adelung in seinem „Lehrgebäude“ eine tolerante Auffassung:<br />
Der Sprachlehrer sei, so schreibt er, nicht Gesetzgeber der Nation, sondern<br />
nur Sammler und Herausgeber der von ihr gemachten Gesetze, ihr Sprecher und<br />
der Dollmetscher ihrer Gesinnungen. Er entscheidet nie, sondern sammelt nur<br />
die entscheidenden Stimmen der meisten. Nie läßt er sich durch Vorurtheil oder<br />
Eigenliebe verleiten, die Gesetze der Nation zu verfälschen, oder ihr seine Meinungen<br />
unterzuschieben. Ausschlaggebend bei der Entscheidung, welcher von<br />
mehreren konkurrierenden Formen- oder Aussprachevarianten im Zweifelsfalle<br />
der Vorzug zu geben sei, war für Adelung demnach also das Majoritätskriterium,<br />
wenn man so will also ein demokratisches Prinzip. Natürlich stand für den Bildungsbürger<br />
des 18. Jahrhunderts außer Frage, dass nur diejenigen Varietäten,<br />
die eine höhere Gesellschaftssprache repräsentierten, überhaupt den Anspruch<br />
erheben durften, als Grundlage für eine künftige einheitliche deutsche Nationalsprache<br />
in Betracht zu kommen.<br />
Ein abschließender Blick auf den exemplarisch ausgewählten Wortartikel Abtritt<br />
aus dem vollständig-kritischen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mag das<br />
Gesagte verdeutlichen.<br />
123