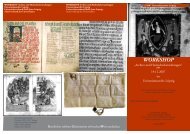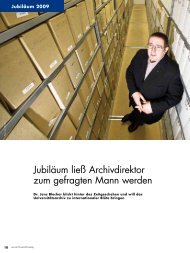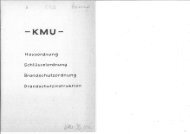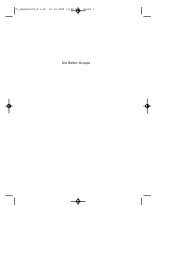Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das <strong>Universität</strong>sjahr 1409 in Prag war kein gutes Jahr – es war geprägt von politischen<br />
Spannungen und konfessioneller Unruhe wegen der Lehren von Johannes<br />
Hus. Zunächst sah es so aus, als würden sich die Auseinandersetzungen von<br />
1384 wiederholen. Als damals der <strong>Universität</strong>skanzler und Erzbischof von Prag<br />
in die Rechte der nichtböhmischen Nationen eingreifen wollte, wehrten sie sich<br />
gegen diese Zumutung mit der Einstellung der Lehrveranstaltungen und einem<br />
Boykott aller akademischen Graduierungen.<br />
Der Streit eskalierte jedoch im Frühjahr 1409 in ungeahnter Weise: Der König<br />
und die Stadtbürger mischten sich zugunsten der böhmischen Nation ein, es<br />
kam zu Gewalttätigkeiten und Blutvergießen – nun entschieden sich die drei<br />
nichtböhmischen Nationen, die Stadt Prag zu verlassen und den Lehrbetrieb in<br />
der Fremde fortzusetzen. Das erzwungene Exil einer ganzen <strong>Universität</strong>, heute<br />
kaum vorstellbar, war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Beispiele dafür finden<br />
sich reichlich, so Paris 1229 (Ausweichorte Orleans, Angers), 1209 Oxford<br />
(Ausweichort Cambridge), 1316 Orleans (Ausweichort Nevers). Nicht immer<br />
kehrten die Ausgezogenen zu ihren früheren Quartieren zurück, fast immer aber<br />
entstanden an den neuen Orten wieder <strong>Universität</strong>en, die den Selbstständigkeits-<br />
und Unabhängigkeitswillen der Vorgängereinrichtung erbten.<br />
Wichtigstes Ziel der Exilanten war die Sicherung ihrer Rechtsgüter in der<br />
Fremde – dank der zumeist wohlwollenden päpstlichen Universalgewalt war das<br />
in der Regel kein allzu großes Problem. Dabei kristallisiert sich das Promotionsrecht<br />
als Hauptmerkmal bei der Konstituierung von neuen <strong>Universität</strong>en heraus.<br />
Die verliehenen Grade verbanden nicht nur die einzeln existierenden Hohen<br />
Schulen miteinander, sondern begründeten daneben innerhalb der christlichen<br />
Gemeinschaft des Abendlandes eine neue soziale Schicht – den Gelehrtenstand.<br />
Die Gleichartigkeit und Vergleichbarkeit der Grade sorgten einerseits für eine<br />
soziale Einordnung des Trägers in der akademischen und nichtakademischen<br />
Welt und andererseits bewirkten sie ein Gemeinschaftsgefühl der Gelehrten<br />
(unabhängig von ihrem Fach, ihrem Alter oder ihrer Herkunft). Mit der päpstlichen<br />
oder kaiserlichen Privilegierung des Promotionsaktes erfolgte zugleich<br />
die sozial hochrangige Einordnung der Titelträger in die Stände-Hierarchie der<br />
Gesellschaft. Aus jedem gradus wurde ein status, der seinem Inhaber gewisse<br />
Vorrechte zusicherte.<br />
Um den Anspruch auf Gleichberechtigung mit den schon bestehenden <strong>Universität</strong>en<br />
zu bekräftigen und um die innere Lebensfähigkeit der Fakultäten zu<br />
demonstrieren, war ein baldiger Beginn des normalen Lehrbetriebs in <strong>Leipzig</strong><br />
nötig. Diesen Anspruch nach außen zu dokumentieren, dazu war nichts besser<br />
176