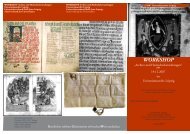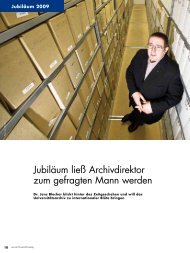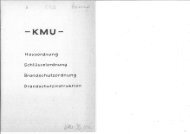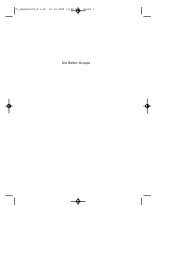Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schung der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre maßgeblich geprägt und ihr<br />
durch die Verbindung von mittelalterlicher Verfassungs- und Landesgeschichte<br />
nachhaltige Impulse gegeben.<br />
Kötzschkes innovativer Paradigmenwechsel hatte sich allerdings schon seit den<br />
20er Jahren mit völkischen Vorstellungen verbunden. Die Schockerfahrung des<br />
Ersten Weltkrieges und Grenzverschiebungen im Osten lenkten den Blick auf<br />
„deutsches Land und deutsches Volkstum“ jenseits der Reichsgrenze und damit<br />
auf die Erforschung der deutschen Ostsiedlung des Mittelalters. Die neuen<br />
landesgeschichtlichen Ansätze mündeten in den 30er Jahren in die sogenannte<br />
Volks- und Kulturbodenforschung, als deren maßgeblicher Vertreter neben<br />
Kötzschke der Bonner Landeshistoriker Hermann Aubin (1885 – 1969) zu nennen<br />
ist. Wie in Bonn resultierte daraus in <strong>Leipzig</strong> eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
mit der Sprachgeschichte und Volkskunde, die sich in dem Werk<br />
„Kulturräume und Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten“ (1936) manifestierte.<br />
Gemeinsam mit seinem Schüler Wolfgang Ebert veröffentlichte Kötzschke<br />
1937 eine „Geschichte der ostdeutschen Kolonisation“, die erste umfassende<br />
Synthese dieses für Sachsen und Mitteldeutschland wie für den gesamten<br />
ostdeutschen und ostmitteleuropäischen Raum bedeutenden Umbruchprozesses.<br />
1935, im Jahr seiner Emeritierung, hat Kötzschke gemeinsam mit dem Dresdner<br />
Archivar Hellmut Kretzschmar die „Geschichte Sachsens“ veröffentlicht. Das<br />
Buch stellt eine bis heute unübertroffene Synthese dar, die durch die vorbildliche<br />
Berücksichtigung der Wirtschafts-, Sozial-, Verfassungs- und Kulturgeschichte<br />
im Kontext der Landes- und Reichsgeschichte noch immer besticht.<br />
Als Nachfolger Kötzschkes wurde 1935 der Österreicher Adolf Helbok berufen,<br />
der durch Arbeiten zur Siedlungsgeschichte für die Fortführung der<br />
<strong>Leipzig</strong>er Neuansätze in der Landesgeschichte geeignet erschien. Allerdings<br />
hatte sich Helbok nicht nur frühzeitig der Volksgeschichte zugewandt, sondern<br />
gefordert, die „Rassekunde“ als neue geschichtswissenschaftliche Methodik zu<br />
berücksichtigen, während sich Kötzschke schon 1927 gegen die Verwendung<br />
des Begriffs „Rasse“ in der Geschichtswissenschaft verwahrt hatte. Nach der<br />
Machtergreifung Hitlers 1933 enthalten zwar manche Veröffentlichungen<br />
Kötzschkes regimekonforme Äußerungen, doch bleibt festzuhalten, dass er sich<br />
langfristig weder weltanschaulich angepasst noch für die NS-Bewegung engagiert<br />
hat. Zu den Protagonisten einer nationalsozialistisch geprägten Volks- und<br />
Kulturraumforschung hat er nicht gehört. Ganz anders sein Nachfolger Adolf<br />
Helbok, dessen <strong>Leipzig</strong>er Antrittsvorlesung über „Die Aufgaben der deutschen<br />
Landes- und Volkstumsgeschichte“ 1935 deutlich machte, dass mit seiner Berufung<br />
eine Neuausrichtung der Landesgeschichte und damit auch des Seminars<br />
140