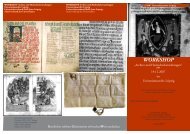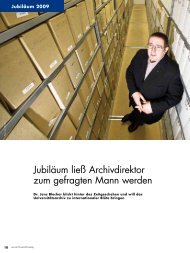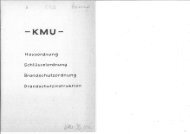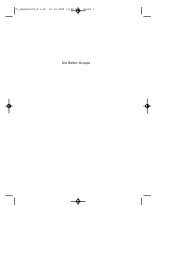Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dünstungen als Ursache für Erkrankungen galten. Im September 1828 konnte<br />
das „zweite Triersche Institut“ in einem Gebäude am Grimmaischen Steinweg<br />
No. 1294, in dem sich vorher Privatwohnungen befanden, eröffnet werden. Im<br />
Erdgeschoss waren ein Auditorium und die Wohnung für den Hausmeister<br />
eingerichtet; in der ersten Etage befanden sich Betten für Wöchnerinnen und<br />
Schwangere, die Wohnung der Hebamme, die Küche und die Speisekammer.<br />
Die zweite Etage war als Wohnung des Direktors hergerichtet. In der dritten<br />
Etage gab es Wohnungen für die Lehrtöchter, Zimmer für wohlhabende zahlende<br />
Schwangere und Wöchnerinnen, die nicht für den Unterricht zur Verfügung<br />
standen, und eine kleine Wohnung für den Assistenzarzt. Insgesamt standen nun<br />
12 Betten zur Verfügung. Laut Jörg konnten in der Anstalt die Wöchnerinnen<br />
vor dem Eindringen des Puerperalfiebers geschützt werden, die Verluste waren<br />
wesentlich geringer als im Dresdner Gebärhaus. Am 28.10.1828 wurde der Hörsaal<br />
eingeweiht.<br />
Mit der Zunahme der Bevölkerung in <strong>Leipzig</strong> stieg auch die Anzahl der Schwangeren,<br />
die wegen Raummangel nicht alle aufgenommen werden konnten. So<br />
plante man einen Anbau. Es entstanden ein Quergebäude mit der Front zur Johannisgasse<br />
und ein Hörsaal; beide Gebäudeteile wurden am 01.08.1853 eröffnet.<br />
Die Bettenzahl hatte sich verdoppelt. Vom 29.12.1853 bis zum 29.06.1854<br />
zählte man 134 aufgenommene und behandelte Mütter. Von Vorteil war auch,<br />
dass nun das Jacobsspital seine Einrichtung zur Aufnahme und Behandlung von<br />
Schwangeren aufheben konnte. Dort wurden nur noch kranke Schwangere bis<br />
zur Geburt betreut, gesunde Schwangere konnten gleich an das Hebammeninstitut<br />
verwiesen werden.<br />
Jörg vertrat als Schüler Boers eine abwartende, genau nach Indikationen vorgehende<br />
Geburtshilfe. Unter seiner Leitung trennte man die Entbindungsschule<br />
von der Hebammenschule. In letzterer wurden „Hebammen in dem unterrichtet,<br />
was sie als solche zu wissen und zu thun nötig haben“. Ein Arzt aber musste<br />
größere Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen. In der Geburtshilfeschule erfuhren<br />
junge Ärzte alles über die Natur des Weibes und des Kindes im Allgemeinen und<br />
über die Funktionen des Schwangerseins und Gebärens im Besonderen.<br />
Hebammen und Ärzte erhielten „wissenschaftlichen, technischen und moralischen“<br />
Unterricht. Die Hebammenausbildung umfasste wöchentlich 4 Stunden<br />
Unterricht in Hebammenkunst, 24 Stunden lang Aufsicht in den Zimmern der<br />
Schwangeren und Wöchnerinnen, einmal in der Woche Untersuchung von<br />
schwangeren Frauen, Anwesenheit und Pflege der Kinder und Wöchnerinnen<br />
und Gebärenden. 1820 gab Jörg für die Ausbildung der Hebammen ein „Lehr-<br />
128