TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
TiHo Bibliothek elib - Tierärztliche Hochschule Hannover
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Material und Methoden<br />
weiblichen Kälber dienten allesamt der Bestandsremontierung, d. h. sie bilden die<br />
Grundlage der zukünftigen Färsenvornutzung.<br />
Haltungsbedingungen im Stall („Stallperiode“):<br />
Während der Stallperiode waren die Tiere gruppenweise in Offenställen<br />
untergebracht. Als Einstreumaterial diente Stroh, das von einem unbelasteten<br />
Standort gewonnen wurde. Der Futtertisch wurde jeden Tag neu befüllt und das<br />
Futter mindestens zweimal täglich herangeschoben. Die Wasserversorgung im Stall<br />
war über mehrere Selbsttränken gesichert.<br />
Haltungsbedingungen auf der Weide („Weidesaison“:)<br />
In den Sommermonaten standen die Färsen auf der betriebseigenen Weidefläche im<br />
Elbdeichvorland. Die Fläche, die den Tieren dabei in den Jahren 2010 + 2011 zur<br />
Verfügung stand, wies jeweils zu Beginn der Weidesaison eine Größe von ca. 17 ha<br />
auf. Nach dem ersten Schnitt zur Grassilagegewinnung wurde die gemähte Fläche<br />
hinzugenommen, so dass sich die Weidefläche auf eine Gesamtfläche von ca. 27 ha<br />
vergrößerte. Im Sommer 2012 wurde die „Weidegruppe“ (siehe 3.2.2.3) der dritten<br />
Gruppe von Färsen von den anderen Tieren des Betriebs separiert. Sie weideten auf<br />
einem Areal, das anteilig zur Gewinnung von Grassilage diente. Der Weideauftrieb<br />
erfolgte erst nach Einholen des ersten Schnittes. Ein Teil der Weidefläche konnte<br />
aufgrund der Gegebenheiten vor Ort gar nicht gemäht werden (Bewuchs mit<br />
Büschen, unebenes Gelände in Nähe der Bracks). Die Weidefläche, auf der die<br />
F III „Weidegruppe“ den Sommer 2012 verbrachte, hatte eine Größe von insgesamt<br />
ca. 4 ha. Von diesen waren ungefähr 3 Hektar reines Grünland, der verbliebene<br />
Hektar wies Buschwerk und Bracks auf. Die Weidefläche grenzte direkt an die Elbe,<br />
die Tiere hatten über einen kleinen Sandstrand jederzeit direkten Zugang zum<br />
Elbwasser. Des Weiteren bestand für diese Färsen auch die Möglichkeit, Wasser aus<br />
zwei auf der Weide befindlichen Wasserstellen (Bracks) aufzunehmen. Diese<br />
„Tränkwasser-Versorgungssituation“ wurde bewusst toleriert, um ein „worst case-<br />
Szenario“ zu initiieren. Eine zusätzliche Tränkwasserversorgung bestand, wie bereits<br />
oben erwähnt, nicht. Sowohl die Fläche, die den Tieren in den Jahren 2010 und 2011<br />
69






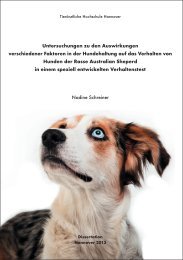



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






