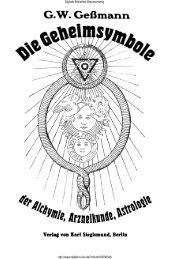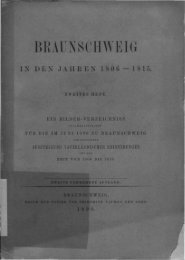Entwicklung alternativer Methoden zur Nukleotid- Analytik in der ...
Entwicklung alternativer Methoden zur Nukleotid- Analytik in der ...
Entwicklung alternativer Methoden zur Nukleotid- Analytik in der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Ergebnisse 78<br />
es jedoch – wie zuvor schon erwähnt – nicht möglich die Wechselwirkungen mit den<br />
e<strong>in</strong>zelnen Additiven weiter zu charakterisieren.<br />
Berücksichtigt man bei <strong>der</strong> Interpretation <strong>der</strong> Aktivitäts-Daten auch die unter 3.2.1.3<br />
erzielten Ergebnisse, so wird deutlich daß mit Elektrode 5 (XOD/Polylys<strong>in</strong>-Beschichtung)<br />
die höchsten Ströme gemessen wurden, dieser Sensor aber zugleich<br />
auch die ger<strong>in</strong>gste Stabilität aufwies. Der Grund hierfür lag wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> <strong>der</strong> erhöhten<br />
enzymatischen H2O2-Produktion, die aus <strong>der</strong> erleichterten Xanth<strong>in</strong>-Diffusion<br />
resultierte, die aber wie<strong>der</strong>um zu e<strong>in</strong>er Schädigung <strong>der</strong> XOD und somit zu e<strong>in</strong>em<br />
schnell e<strong>in</strong>setzenden Aktivitätsverlust des Enzyms führte. Neben e<strong>in</strong>er verän<strong>der</strong>ten<br />
Xanth<strong>in</strong>-Diffusion durch die Enzymmembran könnten jedoch auch weitere XOD/<br />
Additiv-Wechselwirkungen o<strong>der</strong> auch Matrix-Effekte für das Verhalten <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Sensoren verantwortlich gewesen se<strong>in</strong>.<br />
Allgeme<strong>in</strong> waren die entwickelten Plat<strong>in</strong>-Sensoren jedoch mit e<strong>in</strong>er Empf<strong>in</strong>dlichkeit<br />
im Bereich von 50 bis 94 nA/mM nicht geeignet, um die erfahrungsgemäß während<br />
e<strong>in</strong>er Fermentation auftretenden Xanth<strong>in</strong>-Konzentrationen im Bereich von 5 bis 270<br />
µM bestimmen zu können.<br />
3.2.2 XOD-Graphit-Dickschichtelektroden<br />
Da sich sowohl das Elektrodenmaterial Plat<strong>in</strong> als auch die Immobilisierung <strong>der</strong><br />
XOD <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> UV-polymerisierbaren Paste aufgrund <strong>der</strong> mangelnden Stabilität<br />
als nur e<strong>in</strong>geschränkt geeignet <strong>zur</strong> Xanth<strong>in</strong>-Bestimmung erwiesen hatten, wurde mit<br />
Graphit e<strong>in</strong> weiteres Elektrodenmaterial getestet, auf das das Enzym <strong>in</strong> diesem Fall<br />
kovalent über EDC gekoppelt wurde.<br />
3.2.2.1 Untersuchung unspezifischer Signale<br />
Die unter 3.2.1.1 durchgeführten Untersuchungen <strong>zur</strong> Bestimmung unspezifischer<br />
Signale an Pt-Elektroden, wurden mit e<strong>in</strong>er unbehandelten Graphit-Dickschichtelektrode<br />
wie<strong>der</strong>holt. Die aus <strong>der</strong> Injektion von 1 mM H2O2, 1 mM Xanth<strong>in</strong><br />
bzw. 1mM Xanth<strong>in</strong>/5 mM Kaliumhexacyanoferrat resultierenden Ströme s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
Tabelle 16 zusammengefaßt: