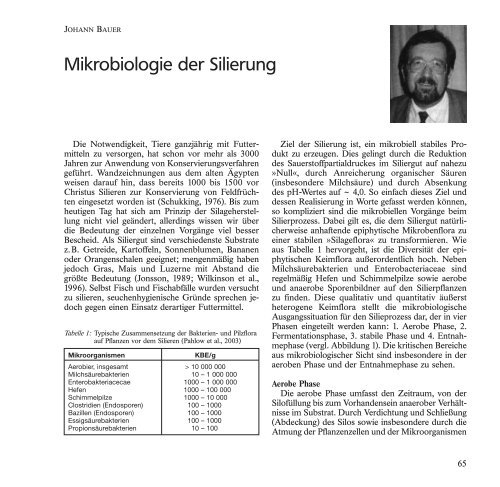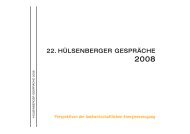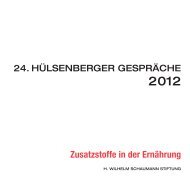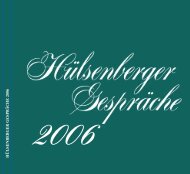Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...
Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...
Broschüre 2004 zum Download (pdf | 1994,28 KB) - H. Wilhelm ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
JOHANN BAUER<br />
Mikrobiologie der Silierung<br />
Die Notwendigkeit, Tiere ganzjährig mit Futtermitteln<br />
zu versorgen, hat schon vor mehr als 3000<br />
Jahren zur Anwendung von Konservierungsverfahren<br />
geführt. Wandzeichnungen aus dem alten Ägypten<br />
weisen darauf hin, dass bereits 1000 bis 1500 vor<br />
Christus Silieren zur Konservierung von Feldfrüchten<br />
eingesetzt worden ist (Schukking, 1976). Bis <strong>zum</strong><br />
heutigen Tag hat sich am Prinzip der Silageherstellung<br />
nicht viel geändert, allerdings wissen wir über<br />
die Bedeutung der einzelnen Vorgänge viel besser<br />
Bescheid. Als Siliergut sind verschiedenste Substrate<br />
z. B. Getreide, Kartoffeln, Sonnenblumen, Bananen<br />
oder Orangenschalen geeignet; mengenmäßig haben<br />
jedoch Gras, Mais und Luzerne mit Abstand die<br />
größte Bedeutung (Jonsson, 1989; Wilkinson et al.,<br />
1996). Selbst Fisch und Fischabfälle wurden versucht<br />
zu silieren, seuchenhygienische Gründe sprechen jedoch<br />
gegen einen Einsatz derartiger Futtermittel.<br />
Tabelle 1: Typische Zusammensetzung der Bakterien- und Pilzflora<br />
auf Pflanzen vor dem Silieren (Pahlow et al., 2003)<br />
Mikroorganismen<br />
<strong>KB</strong>E/g<br />
Aerobier, insgesamt > 10 000 000<br />
Milchsäurebakterien 10 – 1 000 000<br />
Enterobakteriacecae 1000 – 1 000 000<br />
Hefen 1000 – 100 000<br />
Schimmelpilze 1000 – 10 000<br />
Clostridien (Endosporen) 100 – 1000<br />
Bazillen (Endosporen) 100 – 1000<br />
Essigsäurebakterien 100 – 1000<br />
Propionsäurebakterien 10 – 100<br />
Ziel der Silierung ist, ein mikrobiell stabiles Produkt<br />
zu erzeugen. Dies gelingt durch die Reduktion<br />
des Sauerstoffpartialdruckes im Siliergut auf nahezu<br />
»Null«, durch Anreicherung organischer Säuren<br />
(insbesondere Milchsäure) und durch Absenkung<br />
des pH-Wertes auf ~ 4,0. So einfach dieses Ziel und<br />
dessen Realisierung in Worte gefasst werden können,<br />
so kompliziert sind die mikrobiellen Vorgänge beim<br />
Silierprozess. Dabei gilt es, die dem Siliergut natürlicherweise<br />
anhaftende epiphytische Mikrobenflora zu<br />
einer stabilen »Silageflora« zu transformieren. Wie<br />
aus Tabelle 1 hervorgeht, ist die Diversität der epiphytischen<br />
Keimflora außerordentlich hoch. Neben<br />
Milchsäurebakterien und Enterobacteriaceae sind<br />
regelmäßig Hefen und Schimmelpilze sowie aerobe<br />
und anaerobe Sporenbildner auf den Silierpflanzen<br />
zu finden. Diese qualitativ und quantitativ äußerst<br />
heterogene Keimflora stellt die mikrobiologische<br />
Ausgangssituation für den Silieprozess dar, der in vier<br />
Phasen eingeteilt werden kann: 1. Aerobe Phase, 2.<br />
Fermentationsphase, 3. stabile Phase und 4. Entnahmephase<br />
(vergl. Abbildung 1). Die kritischen Bereiche<br />
aus mikrobiologischer Sicht sind insbesondere in der<br />
aeroben Phase und der Entnahmephase zu sehen.<br />
Aerobe Phase<br />
Die aerobe Phase umfasst den Zeitraum, von der<br />
Silofüllung bis <strong>zum</strong> Vorhandensein anaerober Verhältnisse<br />
im Substrat. Durch Verdichtung und Schließung<br />
(Abdeckung) des Silos sowie insbesondere durch die<br />
Atmung der Pflanzenzellen und der Mikroorganismen<br />
65