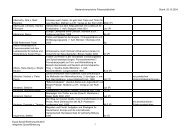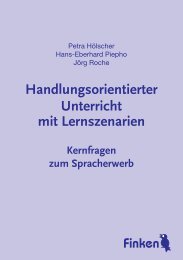Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diese könnten an den Universitäten sowie den Lehrerfortbildungsinstitutionen angesiedelt<br />
sein. Ein Beispiel dafür ist eine in Hessen <strong>von</strong> 1998 bis 2001 durchgeführte Weiterqualifizierungsmaßnahme,<br />
die für Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer im hessischen Schuldienst, die Italienisch<br />
oder Griechisch unterrichteten, <strong>mit</strong> dem Ziel angeboten wurde, ihnen die Unterrichtsbefähigung<br />
für die Gr<strong>und</strong>schule zu ver<strong>mit</strong>teln. Es handelte sich um ein Projekt im Rahmen des<br />
SOKRATES-Programms der Europäischen Union in Kooperation <strong>mit</strong> den Ländern Italien<br />
<strong>und</strong> Griechenland. Auch für Lehrkräfte, die noch nicht im Schuldienst sind, wären solche<br />
Programme sinnvoll. Sie würden darüber hinaus dazu beitragen, dass das Lehrpersonal in den<br />
Schulen in sprachlicher <strong>und</strong> kultureller Hinsicht heterogener <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> besser der Zusammensetzung<br />
der Schülerschaft entsprechen würde.<br />
4.8. Bildungsberichterstattung <strong>und</strong> monitoring<br />
Wie die Studien <strong>von</strong> Radtke u.a. gezeigt haben, greifen im Bildungssystem Mechanismen<br />
„institutioneller Diskriminierung“, die nicht intendiert, gleichwohl aber wirksam Ungleichheit<br />
immer neu hervorbringen <strong>und</strong> die Kinder <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> benachteiligen. Zur<br />
Beobachtung (<strong>und</strong> ggf. Vermeidung) solcher Entwicklungen wird vom Autor ein Ethnic Monitoring<br />
vorgeschlagen, bei dem regelmäßig geeignete stadtteil- <strong>und</strong> schulbezogene Daten<br />
über die Bildungsbeteiligung verschiedener Bevölkerungsgruppen erhoben werden sollen, um<br />
die nicht intendierten Effekte der Entscheidungen im Prozess der Selektion <strong>und</strong> Allokation<br />
<strong>von</strong> Ressourcen zu kontrollieren (vgl. Forum Bildung 11/2001: 40).<br />
Bisher sind Daten über die Bildungsbeteiligung <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong>, die<br />
Merkmale dieser Gruppe (Sprachen, Migrationsgeschichte, Nationalitäten, Sozialdaten der<br />
Eltern) sowie den Einsatz <strong>von</strong> Förder<strong>mit</strong>teln in den B<strong>und</strong>esländern bzw. auf Schulamtsebene<br />
enthalten, kaum vorhanden. Die wenigen amtlichen Statistiken, die solche Merkmale überhaupt<br />
enthalten, sind oft nur schwer zugänglich <strong>und</strong> häufig nicht vergleichbar. Relevante<br />
Daten, insbesondere die Merkmale des „Migrationshintergr<strong>und</strong>s“, werden nicht erhoben <strong>und</strong><br />
können daher auch nicht <strong>mit</strong> Schulerfolgsdaten in Beziehung gesetzt werden. In verschiedenen<br />
Studien, u.a. im Elften Kinder- <strong>und</strong> Jugendbericht der B<strong>und</strong>esregierung (2002) <strong>und</strong> im<br />
Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ (2001) ist auf die Notwendigkeit<br />
einer veränderten <strong>und</strong> erweiterten bildungsrelevanten Sozialberichterstattung hingewiesen<br />
worden, die für die Beobachtung <strong>und</strong> Planung integrationspolitischer Maßnahmen <strong>von</strong> Bedeutung<br />
sind. Unter Bildungsaspekten ist diese Palette erneut zu diskutieren <strong>und</strong> in Verfahren<br />
umzusetzen, nachdem das „Zuwanderungsgesetz“, das einige dieser Erhebungen vorsah, noch<br />
nicht wirksam zustande gekommen ist. Die Themen „Migrationsgeschichte“ <strong>und</strong> „sprachlichkulturelle<br />
Herkunft“ sollten Eingang finden in die diversen, <strong>von</strong> Seiten der Länder <strong>und</strong> des<br />
B<strong>und</strong>es initiierten Aktivitäten zur Innovation der Bildungsberichterstattung.<br />
4.9. Fazit<br />
Die bildungspolitische Lage im Hinblick auf den Umgang <strong>mit</strong> kultureller <strong>und</strong> sprachlicher<br />
Heterogenität stellt sich zusammengefasst so dar, dass zwar in allen B<strong>und</strong>esländern Anstrengungen<br />
zur Berücksichtigung dieses Umstandes unternommen werden – z.T. bereits in einer<br />
Tradition <strong>von</strong> mehr als dreißig Jahren –, diese aber eher den Charakter <strong>von</strong> Zusatz- als <strong>von</strong><br />
Querschnittmaßnahmen besitzen. Aus den Regelungen der B<strong>und</strong>esländer spricht bisher nur<br />
an wenigen Stellen die Anerkennung <strong>von</strong> Heterogenität als Normalfall. Es dominiert eine<br />
zielgruppenbezogene kompensatorische Strategie im Umgang <strong>mit</strong> Differenz. Sprachtests zur<br />
Erfassung <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong>, deren Deutschkenntnisse nicht den Erwartungen an Erstklässler entsprechen,<br />
die Zurückstellung solcher Kinder, die Ausklammerung <strong>von</strong> Flüchtlingskindern aus<br />
der Schulpflicht <strong>und</strong> eine Überrepräsentierung <strong>von</strong> Migrantenkindern an Förderschulen sind<br />
89