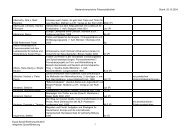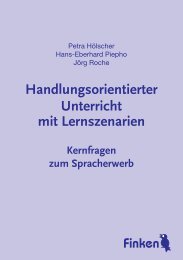Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bei <strong>Kindern</strong>, die zweisprachig aufwachsen, existiert diese relative Homogenität der Quellen für<br />
Sprachaneignung, aus denen sie sich bedienen können, nicht. In der familiären Kommunikation<br />
dieser Kinder wird in vielen Bereichen die Sprache der Herkunft gepflegt. Verschiedene Untersuchungen<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen belegen, dass die <strong>mit</strong>gebrachten Sprachen <strong>von</strong> zugewanderten<br />
Familien auch dann <strong>von</strong> großer Bedeutung sind, wenn sie nicht mehr durchweg in der familialen<br />
Sprachpraxis dominant sind. So fungieren die Sprachen der Herkunft beispielsweise für die<br />
Eltern oft als Sprache der Gefühle oder der Regulierung elementarer Verhaltensformen – also<br />
als wesentliche Sprachen des „Erziehens“. Für die hohe Bedeutung der <strong>mit</strong>gebrachten Sprachen<br />
gerade im Primärspracherwerb spricht auch, dass Geschwister untereinander <strong>mit</strong> den Jüngeren<br />
eher in dieser Sprache kommunizieren, während in der Kommunikation <strong>mit</strong> den Älteren die<br />
umgebende Mehrheitssprache höheres Gewicht erhält (vgl. z.B. Extra/ Verhoeven 1998; siehe<br />
auch die entsprechenden Ergebnisse in Fürstenau/Gogolin/Ya!mur 2003).<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieser Lebensumstände sind Kinder aus Familien <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> in ihrem<br />
allerersten Spracherwerb <strong>von</strong> der Sprache der Herkunft beträchtlich beeinflusst. Mit ihrer<br />
zunehmenden Beweglichkeit erleben sie die dominierende Sprache der weiteren Umgebung, also<br />
hier das Deutsche, als zusätzliche bedeutende Einflussgröße. Diese Sprache unterscheidet sich<br />
nicht, wie dies bei regionalen oder sozialen Varietäten zumeist der Fall ist, nur graduell <strong>von</strong> der<br />
Familiensprache. Sie besitzt vielmehr einen deutlich anderen linguistischen Bestand – auch im<br />
Sinne der Konventionen <strong>und</strong> Traditionen, die das Sprechen im engeren Sinne begleiten (z.B.<br />
Mimik, Gestik <strong>und</strong> andere körpersprachliche Mittel; <strong>mit</strong>schwingende Bedeutungen <strong>von</strong> Redewendungen<br />
usw.). Dem Einfluss dieser weiteren Sprache kann das Kind nicht entgehen – auch<br />
dann nicht, wenn sie innerhalb der Familie selbst nicht oder kaum gesprochen wird: das Deutsche<br />
dringt durch Massenmedien, durch soziale Kontakte <strong>und</strong> durch die symbolische Ordnung<br />
des öffentlichen Raums in die familiale Kommunikation ein, <strong>und</strong> es umgibt das Kind, sobald es<br />
die eigene Wohnung verlässt. Daher ist unabhängig <strong>von</strong> der in einer Familie konkret ausgeübten<br />
Sprachpraxis da<strong>von</strong> auszugehen, dass Kinder <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> im Primärspracherwerb<br />
unterschiedliche Formen <strong>von</strong> Bilingualität entwickeln. Die genaue Ausprägung dieser Formen<br />
ist <strong>von</strong> der konkreten Lebenslage einer Familie abhängig: <strong>von</strong> ihren Sprachpraktiken, ihren<br />
sozialen Beziehungen, dem Medienkonsum <strong>und</strong> sonstigen Lebensumständen. Die wenigen hierzu<br />
aus dem deutschsprachigen Raum vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass höchst unterschiedliche<br />
Kompositionen aus Familien- <strong>und</strong> Umgebungssprache bei solchem Primärspracherwerb<br />
zustande kommen (vgl. z.B. Deutsches Jugendinstitut 1999 ff.; Reich 2001 ff.). In Bezug<br />
auf beide Sprachen sind zumeist mehr oder weniger deutliche Unterschiede zu den Formen des<br />
Sprachbesitzes bemerkbar, wie sie <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> entwickelt werden, die einsprachig in einer der<br />
beteiligten Sprachen aufwachsen. Diese Unterschiede können sich – je nach der jeweiligen<br />
konkreten Sprachsituation <strong>und</strong> abhängig vom Sprachkontakt – in allen sprachlichen Bereichen<br />
zeigen.<br />
Diese Abweichungen <strong>von</strong> der „Normalerwartung“ führten vielfach zu der Befürchtung einer<br />
gestörten, gefährdeten oder defizitären Sprachentwicklung bei zweisprachig Aufwachsenden.<br />
Betrachtet man aber die sprachpsychologische Seite des Spracherwerbs, so ist diese Befürchtung<br />
gr<strong>und</strong>los (vgl. z.B. List 1985; Bia"ystok/Hakuta 1994). Eine Ursache für die an der Oberfläche<br />
der Sprachproduktion mehr oder weniger deutlich bemerkbaren Unterschiede ist der schon<br />
erwähnte Umstand, dass alles Lernen <strong>von</strong> weiteren Sprachen <strong>von</strong> einem durch Erfahrung<br />
ausgearbeiteten Nervensystem gesteuert wird. Jeder Spracherwerb, der sich nach der allerersten<br />
Phase vollzieht, ruht auf der Erfahrung der vorherigen Sprachaneignung auf <strong>und</strong> ist durch sie<br />
bestimmt. Der Einfluss betrifft alle sprachlichen Bereiche: Jede neue linguistische Information<br />
durchläuft gleichsam den Filter des <strong>mit</strong> den ersten Spracherfahrungen angesammelten Bestands<br />
an Informationen. Auch die Aneignung <strong>von</strong> konventionellen Bedeutungen <strong>und</strong> die Teilhabe an<br />
Traditionen <strong>und</strong> am Alltagswissen ist in dieser Weise beeinflusst <strong>von</strong> den allerersten Spracher-<br />
41