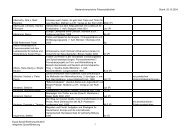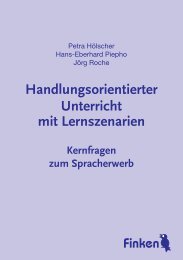Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
fahrungen.<br />
Eine gute Illustration dessen bietet die Aneignung des Lautbestands <strong>von</strong> Sprachen. Ein kleines<br />
Kind kann in seinen ersten Lebenswochen den gesamten auf der Welt vorfindlichen Lautbestand<br />
menschlicher Sprachen artikulieren. Diese Plastizität aber geht im Laufe des ersten Lebensjahres<br />
mehr oder weniger stark zurück, da sich der Lautbildungs- <strong>und</strong> -wahrnehmungsapparat auf<br />
denjenigen konkreten Bestand an Lauten <strong>und</strong> Melodien einrichtet, der praktisch in der Umgebung<br />
des Kindes ausgeübt wird. So kommt es zu dem nicht selten zu beobachtenden Phänomen,<br />
dass Menschen zwar zwei oder mehr Sprachen erstklassig beherrschen, aber doch nie einen<br />
„Akzent“ verlieren, der darauf deutet, dass ihre erste Spracherfahrung vom Lautbestand einer<br />
anderen Sprache geprägt wurde.<br />
Zweisprachiges Aufwachsen als solches gefährdet die Sprachaneignung nicht, aber es sorgt für<br />
Unterschiede im Sprachbesitz, in denen die spezifische Sprachaneignungssituation zum Ausdruck<br />
kommt. Die Unterschiede im Sprachbesitz Einsprachiger <strong>und</strong> Zweisprachiger bei ihrem<br />
Eintritt in die institutionelle Sprachförderung können als Fingerzeige darauf gelesen werden,<br />
dass spezifische Fördermaßnahmen <strong>von</strong>nöten sind, <strong>und</strong> die Erfahrungen <strong>mit</strong> entsprechenden<br />
Programmen, auf die wir weiter unten eingehen, belegen, dass spezifische Maßnahmen zum<br />
Erfolg führen. Wo Gefährdungen der Sprachaneignung bei Zweisprachigen im weiteren Verlauf<br />
ihrer Sprachentwicklung beobachtet werden, sind die Ursachen dafür nicht in der Zweisprachigkeit<br />
als solcher zu suchen, sondern in den Bedingungen, unter denen sie zustande kommt. Hier<br />
sind soziale Zusammenhänge zu berücksichtigen, etwa eine allgemeine Sprach- <strong>und</strong> Bildungsferne<br />
der Familie oder andere allgemein entwicklungshemmende Sozialisationsbedingungen wie<br />
Vernachlässigung, Misshandlung, psychische Traumata. Aber es kann sich auch um ungewollte<br />
Nebenwirkungen <strong>von</strong> institutioneller Sprachförderung handeln; hierauf kommen wir später<br />
zurück.<br />
3.2.3. Sprachbesitz zweisprachiger Kinder beim Eintritt in die Erziehungs- bzw.<br />
Bildungsinstitutionen<br />
Um den Sprachbesitz <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> angemessen beschreiben zu<br />
können, reicht die Feststellung, dass sie <strong>mit</strong> zwei Sprachen leben, nicht aus. Vielmehr weisen<br />
diese beiden Sprachen noch in sich beträchtliche Besonderheiten auf, die für die Sprachaneignung<br />
<strong>von</strong> Bedeutung sind. Diese sollen hier umrissen werden, um die Komplexität der Konstellation<br />
anzuzeigen, in der sich Spracherwerb in der Migration vollzieht.<br />
Die <strong>mit</strong>gebrachte Sprache der Familie weist im Migrationszusammenhang in der Regel Merkmale<br />
auf, die sie <strong>von</strong> der Variante derselben Sprache, die in der ursprünglichen Herkunftsregion<br />
oder anderswo in der Welt gesprochen wird, deutlich unterscheidbar macht. In den Sprachen der<br />
Zuwanderer zeigt sich dasselbe Phänomen, wie es z.B. an den verschiedenen „Englischs“<br />
weltweit ablesbar ist: Sprachen verändern sich in neuen Lebensumgebungen. Das Englisch in<br />
Indien unterscheidet sich vom Englischen in Südafrika oder in Südengland. Das Türkisch der<br />
Türken in Deutschland ist nicht identisch <strong>mit</strong> dem Türkisch in der Türkei <strong>und</strong> beide unterscheiden<br />
sich vom Türkisch der Türkischsprechenden in England, Frankreich oder jeder anderen<br />
Sprachregion. Das rührt daher, dass Sprachen „lebendig“ sind: Sie werden <strong>von</strong> den Menschen,<br />
die sie benutzen, an die Verhältnisse angepasst, für deren Besprechung sie dienen. Die Sprachen<br />
der Migranten stehen vor allem unter dem massiven Einfluss der sie umgebenden Mehrheitssprachen.<br />
Dies macht sich an Veränderungen des Wortbestands zu allererst bemerkbar; Beispiele<br />
hierfür sind Einmischungen <strong>von</strong> deutschen Wörtern oder Redewendungen in die hiesigen<br />
42