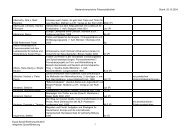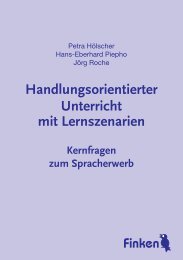Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
drücklich in ihre Verordnungen <strong>und</strong> Erlasse aufgenommen. Es gilt der Gr<strong>und</strong>satz der Integration,<br />
d.h. der gemeinsamen Aufnahme <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> in die Schule, unabhängig <strong>von</strong> ihrem<br />
kulturellen oder sprachlichen Hintergr<strong>und</strong>. Einige B<strong>und</strong>esländer gehen so weit, prinzipiell<br />
keine segregierenden Vorbereitungsmaßnahmen (z.B. Vorbereitungsklassen) im ersten <strong>und</strong><br />
zweiten Schuljahr einzurichten. Einzig Hessen sieht <strong>mit</strong> seinem neuen Schulgesetz vom August<br />
2002 in § 58(5) die Möglichkeit einer Zurückstellung vor. Ohne ausdrücklich im Schulgesetz<br />
vorgesehen zu sein, kommen Zurückstellungen aus sprachlichen Gründen allerdings<br />
auch in anderen B<strong>und</strong>esländern vor. Es ist unklar, in welchem Maß Migrantenkinder <strong>von</strong><br />
Zurückstellungen betroffen sind, da die Staatsangehörigkeit in den Einschulungsdaten nicht<br />
vermerkt ist. Die Schulentwicklungsforschung geht jedoch da<strong>von</strong> aus, dass sie überproportional<br />
<strong>von</strong> Selektionsentscheidungen zu Beginn <strong>und</strong> während der Schullaufbahn betroffen sind<br />
(Bellenberg 1999).<br />
Wie Studien <strong>von</strong> Radtke u.a. (z.B. Gomolla & Radtke 1999) gezeigt haben, kann die Zurückstellung<br />
<strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> als eine Form „struktureller Diskriminierung“<br />
im Bildungssystem interpretiert werden, die als Mechanismus – also nicht durch die<br />
Pädagoginnen <strong>und</strong> Pädagogen intendiert – zur Benachteilung dieser Kinder beiträgt. Eine<br />
weitere benachteiligende Weichenstellung ist die Überweisung an Sonder- bzw. Förderschulen,<br />
in denen der überproportionale Anteil <strong>von</strong> Migrantenkindern weiter wächst (Kornmann<br />
2001, 2002). Die Schulen haben nach diesen Studien Praxen <strong>und</strong> Routinen entwickelt, die im<br />
Bemühen um Funktionsfähigkeit, Effektivität <strong>und</strong> Bestandserhalt dazu beitragen, Diskriminierungen<br />
in Gang zu halten. Im Zuge der Begründung <strong>von</strong> Einzelentscheidungen (z.B. Zurückstellungen,<br />
Sonderschulüberweisungen) würden ethnische Merkmale „valorisiert“, bekämen<br />
also eine Bedeutung, die sie bis dahin nicht besaßen <strong>und</strong> die keine Erklärungskraft<br />
besitzen (z.B. Nationalität). Solche Prozesse müssten systematisch beobachtet <strong>und</strong> auf ihre<br />
strukturellen Gründe (z.B. Fehlplanungen in der Prognostik der Schülerzahl, mangelnde<br />
Auslastung <strong>von</strong> vorschulischen Einrichtungen, Förderschulen bzw. Überlast <strong>von</strong> Gr<strong>und</strong>schulen<br />
etc.) zurückgeführt werden.<br />
Nachgewiesen wurde, dass das Risiko eines schulischen Misserfolgs <strong>mit</strong> Zurückstellungen<br />
<strong>und</strong> der Wiederholung <strong>von</strong> Klassenstufen wächst. In der bei PISA identifizierten „Risikogruppe“<br />
sind solche Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler überproportional häufig enthalten. Eine Lösung<br />
wird in einigen B<strong>und</strong>esländern darin gesucht, <strong>von</strong> Zurückstellung bedrohte oder betroffene<br />
Kinder zur Teilnahme an vorschulischen Fördermaßnahmen zu gewinnen. Dies kann auf<br />
freiwilliger Basis oder verpflichtend (nach Eintritt der Schulpflicht) geschehen. Voraussetzung<br />
ist in der Regel eine Einschätzung der Sprachentwicklung im Deutschen – diskutiert<br />
werden Zeitpunkte <strong>von</strong> eineinhalb Jahren bis einem halben Jahr vor der Einschulung.<br />
So wurde bereits früher – z.B. in Nordrhein-Westfalen <strong>und</strong> Hamburg in den 1980er Jahren –<br />
die Einrichtung <strong>von</strong> Vorlaufgruppen für Kinder, die keine vorschulische Einrichtung besuchen,<br />
erprobt. Zur Erfassung der Kinder wird der Anmeldezeitpunkt vorgerückt (z.B. in Hessen,<br />
Niedersachsen <strong>und</strong> Schleswig-Holstein auf den Herbst des Vorjahres) <strong>und</strong> in Kombination<br />
<strong>mit</strong> einer Einschätzung des Sprachstands des Kindes im Deutschen eine entsprechende<br />
Empfehlung an die Eltern ausgesprochen. In einer ersten Erprobungsphase (2002-2003) wurden<br />
in Hessen ca. 5000 Kinder erfasst <strong>und</strong> 569 Vorlaufkurse für sie eingerichtet.<br />
4.3. <strong>Förderung</strong> im Regelunterricht<br />
Reine Submersionsprogramme zur Eingliederung <strong>von</strong> Zuwandererkindern aus dem Ausland<br />
werden in der B<strong>und</strong>esrepublik nicht vertreten. So schloss sich die KMK im September 2001<br />
erneut dem Ergebnis der Spracherwerbsforschung (vgl. Reich/Roth u.a. 2003: 24) an, dass<br />
64