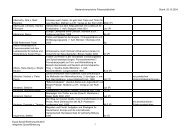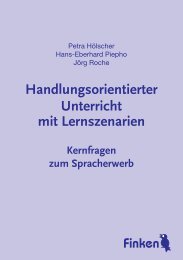Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
struktur entwickelt werden konnte. Für die Integration interkultureller Bildung in die Lehre<br />
kann die Arbeit der „Hamburger Kommission Lehrerbildung“ als wegweisend gelten. Sie<br />
legte im September 2000 einen Reformvorschlag vor, in dem sie drei „prioritäre Themen“<br />
benennt, die in Verbindung <strong>mit</strong> Kerncurricula in der ersten <strong>und</strong> zweiten Phase der Lehrerausbildung<br />
verbindlich angeboten werden sollen (vgl.Keuffer/ Oelkers 2002): „Neue Medien“,<br />
„Umgang <strong>mit</strong> kultureller <strong>und</strong> sozialer Heterogenität“ sowie „Schulentwicklung“. Die Kommission<br />
sah im dem zweiten – hier interessierenden – Bereich einen erheblichen Steuerungsbedarf,<br />
weil die Lehrerbildung bisher „nur zurückgenommen reagiert“ habe. Seitdem ist ein<br />
Entwicklungsprozess in Gang gekommen, an dem alle Institutionen der Lehrerbildung in<br />
Hamburg beteiligt sind. Es wurden Kerncurricula vereinbart, in die Fragen sprachlicher, ethnischer,<br />
kultureller <strong>und</strong> Geschlechterdifferenz systematisch eingearbeitet sind. Sie legen fest,<br />
welche Inhalte in den erziehungswissenschaftlichen, fachdidaktischen <strong>und</strong> fachwissenschaftlichen<br />
Teilen der Ausbildung verbindlich sind <strong>und</strong> wie sie sich auf die Ausbildungsphasen<br />
verteilen. Ziel ist es, dass alle Lehrkräfte Gelegenheit bekommen, sich Gr<strong>und</strong>kenntnisse in<br />
Fragen <strong>von</strong> Spracherwerb, Deutsch als Zweitsprache <strong>und</strong> innersprachlicher Heterogenität<br />
anzueignen, um einen bewussten <strong>und</strong> zielgruppengerechten Einsatz der Unterrichtssprache<br />
Deutsch in jedem Fach zu erreichen. Inwieweit es gelingen wird, diesen Prozess erfolgreich<br />
zu gestalten, ist derzeit noch offen.<br />
Fortbildungsangebote, die sich auf die gesamte Themenbreite interkultureller Bildung beziehen,<br />
werden in allen B<strong>und</strong>esländern auf regionaler <strong>und</strong> zentraler Ebene gemacht; sie reichen<br />
<strong>von</strong> Einzelveranstaltungen bis zu systematischen <strong>und</strong> regelmäßigen Angeboten eigener Abteilungen<br />
in den entsprechenden Instituten. Es richtet sich auf die Systemebene zur Entwicklung<br />
schulbezogener Förderkonzepte (SCHILF, z.B. in Berlin, Hessen, Hamburg, Norhrhein-<br />
Westfalen), Deutsch als Zweitsprache in Vorbereitungs- <strong>und</strong> Regelklassen (alle B<strong>und</strong>esländer),<br />
den Herkunftssprachenunterricht (z.B. Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-<br />
Westfalen, Rheinland-Pfalz), Religionsunterricht (z.B. Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern)<br />
<strong>und</strong> interkulturelles Lernen (alle B<strong>und</strong>esländer). Wie in der Ausbildung ist auch in der<br />
Lehrerfortbildung die Berücksichtigung interkultureller <strong>und</strong> sprachlicher Fragen als Querschnittaufgabe<br />
in den Fächern weitgehend ein Desiderat.<br />
Innerhalb der B<strong>und</strong>esrepublik lag der Schwerpunkt der Fortbildung für die „ausländischen<br />
Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer“ in Nordrhein-Westfalen <strong>und</strong> in Hessen, weil in diesen beiden B<strong>und</strong>esländern<br />
die Schulaufsicht über den herkunftssprachlichen Unterricht auf der deutschen<br />
Seite liegt <strong>und</strong> die Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer fest angestellt sind <strong>und</strong> in Hessen als einzigem<br />
B<strong>und</strong>esland dieser Unterricht ein Pflichtfach für „ausländische Schüler“ war. Mit der politischen<br />
Umorientierung der Landes Hessen seit 1998 wurden in der sprachlichen Bildung andere<br />
Schwerpunkte gesetzt: Der muttersprachliche Unterricht soll auslaufen <strong>und</strong> die Lehrkräfte<br />
sollen – soweit sie über unbefristete Verträge verfügen – neue Aufgaben wahrnehmen.<br />
Die Inhalte <strong>und</strong> Ziele der Fortbildung wurden entsprechend auf diese Beratungsfunktion verlagert.<br />
Auch in Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2002 eine deutliche Reduzierung der<br />
Stellen für Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer im herkunftssprachlichen Unterricht eingeleitet <strong>mit</strong> den<br />
entsprechenden Folgen für die Fortbildung. Allerdings stehen hier aufgr<strong>und</strong> des Studiengangs<br />
im Lehramt Türkisch künftig Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer zur Verfügung, die <strong>mit</strong> gleicher Qualifikation<br />
<strong>und</strong> Besoldung wie alle anderen Lehrkräfte flexibel einsetzbar sind <strong>und</strong> den herkunftssprachlichen<br />
Unterricht in der Sprache Türkisch erteilen können. Ihr Fortbildungsbedarf<br />
wird ebenso wie der <strong>von</strong> Lehrkräften anderer Minderheitensprachen sowie für den bilingualen<br />
Unterricht auch künftig gedeckt werden müssen.<br />
Sinnvoll <strong>und</strong> nötig wären Maßnahmen zur Anpassungsqualifizierung <strong>von</strong> Migrantinnen <strong>und</strong><br />
Migranten, die in ihren Herkunftsländern als Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer ausgebildet wurden.<br />
88