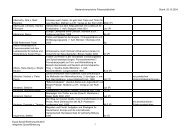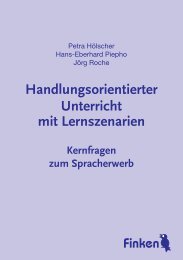Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ischen Sprachzusammensetzung in den Blick zu nehmen. Es stellt sich die Frage, ob sie ihre<br />
Ziele erreichen können, neben der Einführung der monolingual deutschen Kinder in eine andere<br />
Sprache <strong>und</strong> neben der schulischen Bildung der Herkunftssprachen für die zweisprachigen<br />
Kinder auch Auswirkungen auf einen besseren Erwerb der Zweitsprache Deutsch für diese<br />
Kinder zu erbringen <strong>und</strong> auf diese Weise tendenziell die amerikanische Modellevaluation zu<br />
bestätigen. Die ersten Evaluationsergebnisse eines entsprechenden Hamburger Schulversuch<br />
deuten in diese Richtung: Die Fortschritte der Kinder, die ohne oder <strong>mit</strong> nur sehr geringen<br />
Deutschkenntnissen eingeschult wurden, sind erheblich. Die zweisprachigen Kinder entwickelten<br />
sich schon im ersten Schuljahr sowohl im Deutschen als auch in der Partnersprache deutlich<br />
weiter (Gogolin/Neumann/Roth 2003). Allerdings sind die Schulversuchsklassen erst in der<br />
dritten Jahrgangsstufe angekommen, so dass weiter reichende Aussagen noch nicht möglich sind.<br />
Über den Berliner Schulversuch „Staatliche Europaschulen“ liegen bis auf eine Pilotstudie keine<br />
empirischen Ergebnisse vor. Die Untersuchung zur sprachlichen Entwicklung einer italienischdeutschen<br />
Klasse ergab, dass die Erstsprachkompetenz durch den gleichzeitigen gesteuerten<br />
Erwerb <strong>von</strong> zwei Sprachen nicht beeinträchtigt wird. In den Gr<strong>und</strong>fertigkeiten Hören, Sprechen,<br />
Lesen <strong>und</strong> Schreiben entsprach das dort bis zum Ende des zweiten Schuljahrs erreichte Niveau<br />
dem Durchschnitt der monolingualen Kontrollgruppen. Das galt auch für die italienische Sprachgruppe.<br />
Allerdings wurden bei einigen der zweisprachigen Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler trotz guter<br />
Fortschritte noch erhebliche Schwächen im Italienischen festgestellt. Im Deutschen als Zweitsprache<br />
hingegen wurden kontinuierliche Fortschritte beobachtet (vgl. Graefe-Bentzien 2001).<br />
Die Autorin verweist ebenfalls auf die Vorläufigkeit der Ergebnisse angesichts der nicht abgeschlossenen<br />
Gr<strong>und</strong>schulzeit der untersuchten Kinder. Ein für weitere Untersuchungen nicht<br />
unerhebliches Teilergebnis ist darin zu sehen, dass sich weder der Besuch einer vorschulischen<br />
Einrichtung noch der familiäre Hintergr<strong>und</strong> als erklärend für besondere Lernfortschritte in beiden<br />
Sprachen erwiesen, hingegen das allgemeine kommunikative Verhalten bedeutsam zu sein<br />
scheint.<br />
Ein weiteres bilinguales Modell, die deutsch-italienische Schule in Wolfsburg, hat die Evaluation<br />
<strong>von</strong> vier Jahrgängen der Gr<strong>und</strong>schule abgeschlossen. Im Ergebnis stehen gute Ergebnisse für das<br />
Italienische sowie eine hohe Schulzufriedenheit gerade der zweisprachigen Kinder. Die Abstände<br />
in den Leistungen im Deutschen zwischen den einsprachig deutschen <strong>und</strong> den zweisprachigen<br />
<strong>Kindern</strong> sind jedoch klar erkennbar. Zwar erreichen die zweisprachigen als Gruppe einen<br />
insgesamt guten Testwert, aber immerhin ein Viertel dieser Kinder wird weiterhin als förderungsbedürftig<br />
im Deutschen als Zweitsprache betrachtet (Sandfuchs/Zumhasch 2002). Die<br />
Autoren sehen einen wesentlichen Gr<strong>und</strong> dafür in nicht gelungener Zweitsprachförderung <strong>und</strong><br />
plädieren für eine Intensivierung dieses Unterrichts. Das Wolfsburger Ergebnis macht noch<br />
einmal deutlich, dass die Frage der <strong>Förderung</strong> in der Herkunftssprache <strong>und</strong> der <strong>Förderung</strong> des<br />
Deutschen als Zweitsprache nicht in Opposition zueinander stehen, sondern als einander ergänzende<br />
Elemente einer umfassenden sprachlichen Bildung für Kinder <strong>mit</strong> anderen Familiensprachen<br />
betrachtet werden können <strong>und</strong> sollten.<br />
3.2.5. Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Anschlussfragen<br />
Für die B<strong>und</strong>esrepublik liegen nur punktuelle <strong>und</strong> lokale Studien über die Auswirkungen des<br />
Unterrichts im Deutschen als Zweitsprache vor. Das gleiche gilt für die Effekte einer <strong>Förderung</strong><br />
in der Herkunftssprache für das Lernen der Zweitsprache Deutsch. Die vornehmlich aus den<br />
USA, den Niederlanden <strong>und</strong> Österreich vorliegenden Ergebnisse besagen, dass Merkmale der<br />
Implementierung <strong>von</strong> Programmen, die didaktische Gestaltung des Unterrichts sowie die Koor-<br />
48