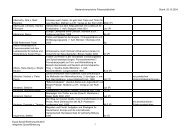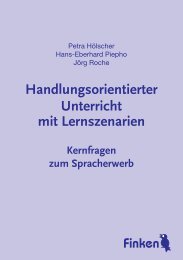Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sen/Förderunterricht) <strong>und</strong> der „Muttersprachliche Ergänzungsunterricht“, für den die B<strong>und</strong>esländer<br />
in unterschiedlichem Maß Verantwortung übernahmen (<strong>mit</strong> eigenen, vom Land<br />
beschäftigten <strong>und</strong> beaufsichtigten Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen,<br />
Rheinland-Pfalz; in Kooperation <strong>mit</strong> den konsularischen Vertretungen der ehemaligen<br />
Anwerbeländer unter Aufsicht des B<strong>und</strong>eslandes in Bayern; in Kooperation <strong>mit</strong> den Konsulaten<br />
ohne eigene Schulaufsicht in Schleswig-Holstein, Berlin, Baden-Württemberg; in beiden<br />
Formen in Hamburg).<br />
Mit der KMK-Empfehlung „Interkulturelle Bildung <strong>und</strong> Erziehung in der Schule“ wurde ein<br />
gr<strong>und</strong>legender bildungspolitischer „Perspektivwechsel“ proklamiert. Ausgangspunkt war die<br />
Feststellung, dass die Schülerschaft sprachlich <strong>und</strong> kulturell heterogen sei. Diesem pädagogisch<br />
relevanten Umstand müsse dadurch Rechnung getragen werden, dass die Schule nicht<br />
nur in der Form <strong>von</strong> Sondermaßnahmen auf eine spezifische Gruppe reagieren könne, sondern<br />
interkulturelle Erziehung <strong>und</strong> Bildung als Querschnittaufgabe der Schule aufzufassen<br />
sei. Die Neuorientierung drückte sich im Bereich der sprachlichen Bildung so aus, dass in<br />
einigen B<strong>und</strong>esländern „Herkunftssprachlicher Unterricht“ eingeführt wurde, der nicht mehr<br />
<strong>mit</strong> dem Rückkehrgedanken begründet wurde, sondern die individuelle Zwei- <strong>und</strong> Mehrsprachigkeit<br />
<strong>von</strong> Migrantenkindern als Ressource verstehen <strong>und</strong> fördern sollte. Die sprachlichen<br />
Fähigkeiten der Kinder <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> sollten für alle Kinder genutzt werden<br />
(Konzept des Begegnungssprachenunterrichts in Nordrhein-Westfalen) <strong>und</strong> dem Katalog der<br />
Sprachen aus der „Gastarbeiterzeit“ wurden weitere Sprachen hinzugefügt (z.B. Bulgarisch in<br />
Sachsen, Kurdisch in Hessen <strong>und</strong> Nordrhein-Westfalen, Dari <strong>und</strong> Farsi in Hamburg).<br />
Eine explizite Ausrichtung auf Zweisprachigkeit findet sich z.B. im 1997 in Kraft getretenen<br />
Schulgesetz <strong>von</strong> Hamburg; darin heißt es in §3: „Kinder <strong>und</strong> Jugendliche, deren Erstsprache<br />
nicht Deutsch ist, sind unter Achtung ihrer ethnischen <strong>und</strong> kulturellen Identität so zu fördern,<br />
dass ihre Zweisprachigkeit sich entwickeln kann <strong>und</strong> ihnen eine aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen<br />
ermöglicht wird“. Dazu wird in einem Länderbericht Hamburgs an die KMK<br />
ausgeführt: „Leitgedanke dieser Regelung ist die ausdrückliche Anerkennung der Zwei-<br />
/Mehrsprachigkeit als individueller <strong>und</strong> gesellschaftlicher Reichtum. Entsprechend sind Unterricht<br />
<strong>und</strong> Erziehung dem Ziel verpflichtet, die Zwei-/Mehrsprachigkeit – auch unter den<br />
Rahmenbedingungen eines dominant monolingualen Unterrichts – bestmöglich zu fördern“<br />
(KMK 2001). Verb<strong>und</strong>en <strong>mit</strong> diesem Ziel war eine Umsteuerung des „Muttersprachlichen<br />
Ergänzungsunterrichts“ in Richtung auf einen „Herkunftssprachlichen Unterricht“, der wie<br />
Deutsch als Zweitsprache dem Aufbau zweisprachiger Kompetenz dienen soll. Derzeit wird<br />
allerdings eine Novellierung des Schulgesetzes vorbereitet, in der die Streichung des o.g.<br />
Paragraphen vorgesehen ist. In Nordrhein-Westfalen wird derzeit (Landtagsauftrag) an einer<br />
auf Mehrsprachigkeit zielenden Konzeption gearbeitet, die Sprachförderung, herkunftssprachlichen<br />
Unterricht <strong>und</strong> weitere Ansätze zur Integration bündeln <strong>und</strong> die Möglichkeit der<br />
Einbindung der Herkunftssprachen in den Regelunterricht beinhalten soll.<br />
4.5.1. Deutsch als Zweitsprache <strong>und</strong> als Sprache der Schule<br />
Die <strong>Förderung</strong> des Deutschen als Zweitsprache hat erneut an Aufmerksamkeit gewonnen <strong>und</strong><br />
wird – wie oben dargestellt – vor allem <strong>mit</strong> Blick auf den Eintritt in die Schule (Kindergarten/Vorschule/erstes<br />
Schuljahr) diskutiert. Zwar weisen vorliegende Forschungsergebnisse<br />
seit langem darauf hin, dass das Problem der <strong>Förderung</strong> des Deutschen als Sprache der<br />
Schule kontinuierlich besteht <strong>und</strong> nicht allein durch vorbereitende Maßnahmen gelöst werden<br />
kann. Dennoch hat die breite Öffentlichkeit erst <strong>mit</strong> dem Vorliegen der PISA-Studie, in der<br />
das Desiderat der Deutschförderung bei den 15-jährigen Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler zutage<br />
trat, <strong>von</strong> diesem Sachverhalt Kenntnis genommen. Auf diesen Bef<strong>und</strong> wurde bildungspolitisch<br />
zunächst schwerpunktmäßig <strong>mit</strong> Maßnahmen für den vorschulischen Bereich <strong>und</strong> die<br />
68