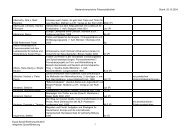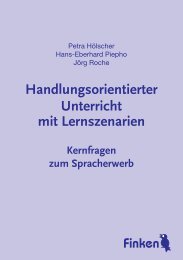Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.2.6. Eine kontinuierliche Herausforderung: Die Sprache der Schule<br />
Unabhängig da<strong>von</strong>, ob Kinder <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> in den Genuss eines spezifischen<br />
Modells der Sprachbildung kommen, das ihre Zweisprachigkeit berücksichtigt, stellt sich das<br />
Problem ihrer adäquaten sprachlichen <strong>Förderung</strong> an jedwede Bildungsinstitution. Es kann, wie<br />
ausgeführt, als gesichert gelten, dass Kinder aus zugewanderten Familien – jedenfalls diejenigen,<br />
die in Deutschland geboren werden oder aufwachsen – in aller Regel <strong>mit</strong> Formen <strong>von</strong> Zweisprachigkeit<br />
aufwachsen <strong>und</strong> in den institutionellen Bildungsprozess eintreten. Die Bedeutung des<br />
Deutschen als allgemeines Verständigungs<strong>mit</strong>tel, <strong>und</strong> erst recht: als Schlüssel zum Bildungserfolg,<br />
wird <strong>von</strong> den Zugewanderten fraglos anerkannt, ohne dass da<strong>mit</strong> verb<strong>und</strong>en wäre, dass sie<br />
deshalb ihre <strong>mit</strong>gebrachten Sprachen aufgeben würden.<br />
Für die Gestaltung <strong>von</strong> Bildungsprozessen im Elementarbereich <strong>und</strong> in der Schule folgt hieraus,<br />
dass Zweisprachigkeit als Bildungsvoraussetzung für die Aneignung <strong>und</strong> Verarbeitung des<br />
Lernangebots dauerhaft relevant bleibt. Der Einfluss der Zweisprachigkeit auf die sprachliche<br />
<strong>und</strong> intellektuelle Entwicklung bleibt auch dann erhalten, wenn keine institutionelle <strong>Förderung</strong><br />
beider Sprachen erfolgt; nicht zuletzt darauf deutet das Ergebnis der PISA-Studie hin, dass<br />
Fünfzehnjährige <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong> trotz des kompletten Durchlaufens einer Schule in<br />
Deutschland geringere Lesekompetenzen erreichen als Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ohne Mihrationshintergr<strong>und</strong>.<br />
Dies zeigt, dass „dieselbe“ <strong>Förderung</strong>, wie sie Einsprachigen gegeben wird, bei<br />
Zweisprachigen zu anderen – schlechteren – Ergebnissen führt.<br />
In Untersuchungen aus der Perspektive interkultureller Bildungsforschung – zum Beispiel im<br />
Rahmen des Schwerpunktprogramms FABER (Folgen der Arbeitsmigration für Bildung <strong>und</strong><br />
Erziehung) der DFG – wurde darauf hingewiesen, dass Maßnahmen, die zur Sprachförderung<br />
in den deutschen Schulen ergriffen wurden, häufig folgende Charakteristika aufweisen, die als<br />
Ursachen für geringe Fördererfolge gelten können:<br />
- Es erfolgte eine weitgehende Konzentration auf das Deutsche – also nur einen Teil der<br />
sprachlichen Gesamtkompetenz der Kinder <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong>.<br />
- Es war vielfach die Gr<strong>und</strong>auffassung leitend, dass man es <strong>mit</strong> einem Übergangsproblem<br />
zu tun habe. Daher wurden Maßnahmen <strong>von</strong> begrenzter Dauer etabliert, in denen eine<br />
Intensivförderung gegeben werden sollte. Die <strong>mit</strong>schwingende Hoffnung oder Annahme<br />
dabei ist, dass am Ende dieser <strong>Förderung</strong> eine Situation erreicht sei, die keine spezifische<br />
Rücksichtnahme oder <strong>Förderung</strong> mehr erforderlich mache, da die Besonderheiten der<br />
Zweisprachigkeit quasi ausgeräumt wären.<br />
Dies aber ist ein Irrtum. Zweisprachigkeit bleibt permanent als Bildungsvoraussetzung erhalten,<br />
<strong>und</strong> nachhaltig positive Einflüsse auf die sprachliche <strong>und</strong> sonstige schulische Entwicklung <strong>von</strong><br />
<strong>Kindern</strong>, die in zwei Sprachen leben, können nicht <strong>von</strong> kurzfristigen Interventionsmaßnahmen<br />
erwartet werden, sondern – wie im vorigen Abschnitt ausgeführt – nur <strong>von</strong> solchen <strong>mit</strong> einem<br />
langen Atem.<br />
Dies hat zur Konsequenz, dass auf die spezifischen sprachlichen Anforderungen der Schule <strong>und</strong><br />
des Unterrichts nicht allein <strong>mit</strong> „Vorbereitung“ reagiert werden kann. Dafür ist verantwortlich,<br />
dass diese Anforderungen sich erst <strong>mit</strong> dem Bildungsprozess selbst entwickeln <strong>und</strong> kontinuierlich<br />
verändern. Angesprochen ist hier das Deutsche als „Sprache der Schule“, das im vorigen<br />
50