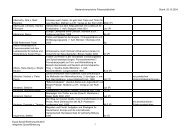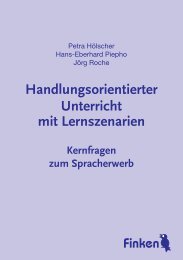Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dem vor allem Flüchtlingsjugendliche Deutschunterricht erhalten <strong>und</strong> – je nach Leistung –<br />
Abschlüsse erwerben können. Da die meisten dieser <strong>Jugendlichen</strong> <strong>mit</strong> einem ungesicherten<br />
Aufenthaltsstatus mehr als drei Jahre nach Abschluss des Asylverfahrens in Deutschland<br />
bleiben, erhalten sie so mindestens die Chance, Deutsch zu lernen <strong>und</strong> eine gewisse Gr<strong>und</strong>bildung<br />
zu erwerben.<br />
In vielen B<strong>und</strong>esländern ist es üblich, die Vorbereitungsklassen der Sek<strong>und</strong>arstufe I zwar<br />
schulformübergreifend, aber dennoch vor allem an Hauptschulen (bzw. den entsprechenden<br />
Formen je nach B<strong>und</strong>esland) einzurichten. Dies hat zur Folge, dass unterproportional Kinder<br />
in Regelklassen an Realschulen oder Gymnasien übergehen. Um dem entgegenzuwirken, hat<br />
es sich als effektiv erwiesen, auch an Gymnasien <strong>und</strong> – falls vorhanden – Gesamtschulen<br />
Vorbereitungsklassen einzurichten. Die erhöhte Zahl <strong>von</strong> <strong>Kindern</strong>, die in der jeweiligen<br />
Schule verbleiben <strong>und</strong> deren Abschlüsse erwerben, kann als ein Hinweis darauf gewertet<br />
werden, dass die Potenziale der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler erkannt <strong>und</strong> besser ausgeschöpft<br />
werden können. So hat z.B. Baden-Württemberg (für Berechtigte nach dem B<strong>und</strong>esvertriebenengesetz)<br />
Sonderlehrgänge an Gymnasien zum Erwerb der Fachhochschulreife <strong>und</strong> Förderklassen<br />
an Realschulen eingerichtet. Auch in Hamburg bestehen seit Jahren „Realschulübergangsklassen“,<br />
in denen die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler nicht nur zum Realschulabschluss,<br />
sondern auch zum Besuch der gymnasialen Oberstufe geführt werden. Einen Versuch, Benachteiligungen<br />
bei Zuweisungsentscheidungen zu verhindern, stellen auch zentrale Prüf<strong>und</strong><br />
Beratungsstellen dar, die über eine differenzierte Kenntnis ausländischer Zeugnisse,<br />
Schulsysteme <strong>und</strong> politischer Verhältnisse verfügen, um die Kinder <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> ihren<br />
Vorkenntnissen gemäß auf Schulen zu verteilen. Entsprechende Erfahrungen wurden z.B. in<br />
den RAA (ursprünglich 1980: „Regionale Arbeitsstellen zur <strong>Förderung</strong> Ausländischer Kinder<br />
<strong>und</strong> Jugendlicher“, heute in 27 Städten <strong>und</strong> Kreisen „Regionale Arbeitsstellen zur <strong>Förderung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> aus Zuwandererfamilien“) in Nordrhein-Westfalen, aber auch<br />
einzelnen Städten (z.B. Düsseldorf) gemacht. In einigen B<strong>und</strong>esländern konnten auch durch<br />
einen flexiblen Umgang <strong>mit</strong> der Anerkennung <strong>von</strong> Sprachkenntnissen aus den Herkunftsländern<br />
<strong>und</strong> ergänzenden Englischangeboten sowie Feststellungsprüfungen die formalen Hindernisse<br />
zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe beseitigt werden.<br />
Eine Evaluation dieser Eingliederungsmaßnahmen hat es – bis auf die Ausnahme des „Krefelder<br />
Modells“ in den 1980er Jahren – nicht gegeben. Die Schwierigkeit liegt u.a. darin, dass<br />
Längsschnittuntersuchungen erforderlich wären <strong>und</strong> Schülerbiografien verfolgt werden<br />
müssten, die <strong>von</strong> häufigen Schul- <strong>und</strong> Ortswechseln, bis hin zu Rück- <strong>und</strong> Weiterwanderungen<br />
(„Transmigration“) beeinflusst sind.<br />
4.5. Sprachliche Bildung<br />
Zu Beginn der bildungspolitischen Maßnahmen zur <strong>Förderung</strong> <strong>von</strong> zuwandernden <strong>Kindern</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> war eine kompensatorische, auf Eingliederung <strong>und</strong> Anpassung der Kinder<br />
an die deutschen Gegebenheiten in Schule <strong>und</strong> Gesellschaft gerichtete Zielsetzung verfolgt<br />
worden. Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich in einigen B<strong>und</strong>esländern eine Umorientierung<br />
in der Perspektive auf den Umgang der Schule <strong>mit</strong> den Folgen der Arbeitsmigration ab, die in<br />
der Gegenwart zum Teil wieder zurückgenommen, zum Teil anders akzentuiert wird. Dies ist<br />
am Feld der sprachlichen Bildung gut abzulesen. Bis in die 1990er Jahre hinein waren die<br />
Anstrengungen zur sprachlichen Bildung <strong>von</strong> dem kompensatorischen Gedanken geprägt,<br />
dass einwandernde Kinder möglichst schnell in das einsprachig deutsche Schulsystem <strong>und</strong><br />
seine Anforderungen eingegliedert werden sollten, aber gleichzeitig die „Rückkehrfähigkeit“<br />
der Kinder erhalten <strong>und</strong> ihre „kulturelle Identität“ gewahrt werden sollte. Mittel dieser „Doppelstrategie“<br />
waren ein Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (Vorbereitungsklas-<br />
67