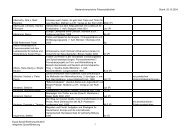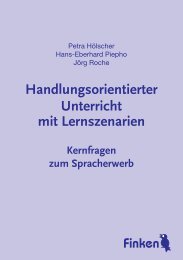Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Durch Messung <strong>von</strong> Hirnaktivitäten wurde z.B. er<strong>mit</strong>telt, dass sich frühkindliche Zweisprachigkeit<br />
insbesondere positiv auf die Fähigkeit zur Ausbildung grammatischer Strukturen in beiden<br />
Sprachen auswirken kann; für die Ausbildung semantischer Strukturen hingegen scheint das<br />
Erwerbsalter weniger bedeutsam (vgl. Wartenburger u.a. 2003). Positive Effekte sind vor allem<br />
hinsichtlich des Erwerbs metasprachlicher Fähigkeiten er<strong>mit</strong>telt worden. Daher stellt zweisprachiges<br />
Aufwachsen – wenn nicht sehr ungünstige Lebensbedingungen vorhanden sind – eine<br />
positive Voraussetzung für die Entwicklung der gesamten sprachlichen <strong>und</strong> geistigen Leistungen<br />
eines Kindes dar. Dies erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass den <strong>Kindern</strong> ihre sprachliche<br />
Umwelt nicht mühelos für die Aneignung sprachlicher Mittel zur Verfügung steht. Sie sind<br />
vielmehr permanent vor besondere Aufgaben gestellt, die einsprachige Kinder nicht so früh <strong>und</strong><br />
intensiv bewältigen müssen. Um diese Anforderungen anzudeuten: Da<strong>mit</strong> sich bilinguale Kinder<br />
in ihrer sprachlichen Umwelt orientieren können, müssen sie lernen, zu unterscheiden, dass sie<br />
es <strong>mit</strong> mehreren Sprachen zu tun haben. Weil die Kinder im Kontakt <strong>mit</strong> Personen sind, die nicht<br />
– wie sie selbst – zweisprachig sind, müssen sie differenzieren lernen, wann, unter welchen<br />
Umständen <strong>und</strong> <strong>mit</strong> wem sie in welcher ihrer Sprachen kommunizieren können. Um je nach<br />
Erfordernis zwischen den Sprachen wechseln zu können, müssen sie sich „Kriterien“ aneignen,<br />
die es ihnen erlauben, ihre sprachlichen Mittel der einen oder anderen Sprache zuzuordnen. Sie<br />
sind zudem stärker als monolinguale Kinder gefordert, Strategien zu entwickeln, die ihnen über<br />
Verstehens- oder Ausdrucksnot hinweghelfen. Für die Erfüllung solcher Aufgaben ist die<br />
Aktivierung <strong>von</strong> metasprachlichen Fähigkeiten <strong>von</strong>nöten: <strong>von</strong> Kompetenzen, die nicht un<strong>mit</strong>telbar<br />
dem Bestand einer konkreten Sprache zuzuordnen, sondern sprachübergreifender Art sind.<br />
Einsprachige Kinder machen besonders intensive Erfahrungen <strong>mit</strong> solchen Aufgaben eigentlich<br />
erst in dem Moment, in dem sie in gesteuerte Sprachausbauprozesse geraten – spätestens also<br />
<strong>mit</strong> dem Eintritt in die Schule <strong>und</strong> der Anforderung des Lesen- <strong>und</strong> Schreibenlernens, die dazu<br />
zwingt, <strong>von</strong> intuitiv beherrschten sprachlichen Mitteln zu abstrahieren, sprachliche Mittel<br />
bewusst, systematisch <strong>und</strong> reflektiert einzusetzen – also metasprachliche Fähigkeiten zu benutzen<br />
(vgl. Bia"ystock 1986). Dass zweisprachige Kinder metasprachliche Fähigkeiten sehr früh<br />
entfalten, gilt als förderliche Voraussetzung für jeden weiteren Spracherwerb <strong>und</strong> die kognitive<br />
Entwicklung (vgl. List 1997).<br />
Wird allein spracherwerbstheoretisches Wissen zugr<strong>und</strong>e gelegt, so kann zusammenfassend<br />
festgestellt werden: Das zweisprachige Aufwachsen führt zu einem Sprachbesitz, der sich sowohl<br />
<strong>von</strong> dem einsprachiger Kinder in der Herkunftsregion als auch <strong>von</strong> dem einsprachig im Einwanderungsland<br />
aufwachsender Kinder ohne Migrationshintergr<strong>und</strong> unterscheidet. Die Beobachtungen<br />
<strong>von</strong> „abweichendem“ sprachlichen Verhalten bilingualer Kinder sind also zutreffend. Sie<br />
zeigen aber keineswegs un<strong>mit</strong>telbar eine gefährdete oder defizitäre Sprachentwicklung an. Die<br />
äußerlich bemerkbaren Anzeichen dafür, dass die Sprachen, aus denen sich das Kind seinen<br />
Sprachbesitz komponiert, <strong>mit</strong>einander in Kontakt stehen, besagen nichts anderes, als dass hier<br />
eine diesen Umständen entsprechende normale Sprachentwicklung geschieht, deren vorläufiges<br />
Ergebnis eine „Muttersprache: Zweisprachigkeit“ ist: eine andere Form der Komposition des<br />
Sprachbesitzes, die nicht einfach Kenntnisse <strong>und</strong> Kompetenzen in zwei Sprachen, sondern auch<br />
sprachliche Mittel umfasst, die aus synergetischen Effekten eines doppelten Erstsprach- oder<br />
verschränkten Erst- <strong>und</strong> Zweitspracherwerbs erwachsen. Prinzipiell sind <strong>mit</strong> zwei- oder mehrsprachigem<br />
Aufwachsen eine Reihe <strong>von</strong> Vorteilen für die sprachliche <strong>und</strong> kognitive Entwicklung<br />
verb<strong>und</strong>en. Allerdings bedarf es, um diese günstigen Voraussetzungen weiterzuentwickeln, ihrer<br />
expliziten Berücksichtigung <strong>und</strong> <strong>Förderung</strong> in den Prozessen gesteuerten sprachlichen Lernens,<br />
die im Elementarbereich oder spätestens in der Schule einsetzen.<br />
Geschieht eine solche zugleich rücksichtsvolle <strong>und</strong> zielgerichtete <strong>Förderung</strong>, so kann da<strong>von</strong><br />
ausgegangen werden, dass zweisprachig aufwachsende Kinder zu umfassender Kommunikati-<br />
44