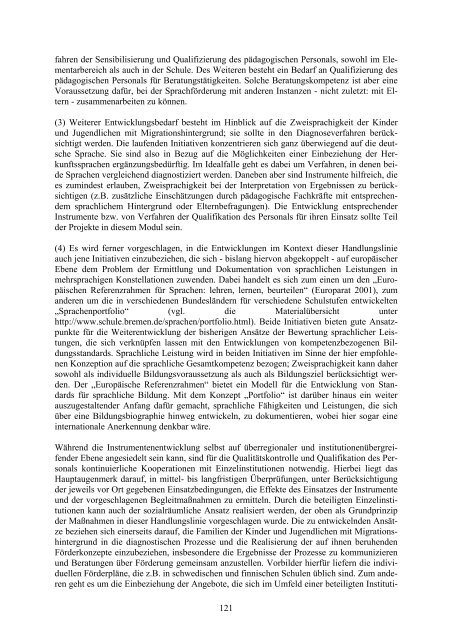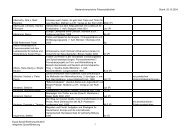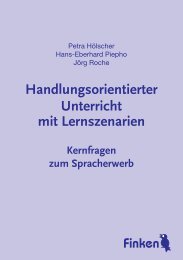Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fahren der Sensibilisierung <strong>und</strong> Qualifizierung des pädagogischen Personals, sowohl im Elementarbereich<br />
als auch in der Schule. Des Weiteren besteht ein Bedarf an Qualifizierung des<br />
pädagogischen Personals für Beratungstätigkeiten. Solche Beratungskompetenz ist aber eine<br />
Voraussetzung dafür, bei der Sprachförderung <strong>mit</strong> anderen Instanzen - nicht zuletzt: <strong>mit</strong> Eltern<br />
- zusammenarbeiten zu können.<br />
(3) Weiterer Entwicklungsbedarf besteht im Hinblick auf die Zweisprachigkeit der Kinder<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong>; sie sollte in den Diagnoseverfahren berücksichtigt<br />
werden. Die laufenden Initiativen konzentrieren sich ganz überwiegend auf die deutsche<br />
Sprache. Sie sind also in Bezug auf die Möglichkeiten einer Einbeziehung der Herkunftssprachen<br />
ergänzungsbedürftig. Im Idealfalle geht es dabei um Verfahren, in denen beide<br />
Sprachen vergleichend diagnostiziert werden. Daneben aber sind Instrumente hilfreich, die<br />
es zumindest erlauben, Zweisprachigkeit bei der Interpretation <strong>von</strong> Ergebnissen zu berücksichtigen<br />
(z.B. zusätzliche Einschätzungen durch pädagogische Fachkräfte <strong>mit</strong> entsprechendem<br />
sprachlichem Hintergr<strong>und</strong> oder Elternbefragungen). Die Entwicklung entsprechender<br />
Instrumente bzw. <strong>von</strong> Verfahren der Qualifikation des Personals für ihren Einsatz sollte Teil<br />
der Projekte in diesem Modul sein.<br />
(4) Es wird ferner vorgeschlagen, in die Entwicklungen im Kontext dieser Handlungslinie<br />
auch jene Initiativen einzubeziehen, die sich - bislang hier<strong>von</strong> abgekoppelt - auf europäischer<br />
Ebene dem Problem der Er<strong>mit</strong>tlung <strong>und</strong> Dokumentation <strong>von</strong> sprachlichen Leistungen in<br />
mehrsprachigen Konstellationen zuwenden. Dabei handelt es sich zum einen um den „Europäischen<br />
Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen“ (Europarat 2001), zum<br />
anderen um die in verschiedenen B<strong>und</strong>esländern für verschiedene Schulstufen entwickelten<br />
„Sprachenportfolio“ (vgl. die Materialübersicht unter<br />
http://www.schule.bremen.de/sprachen/portfolio.html). Beide Initiativen bieten gute Ansatzpunkte<br />
für die Weiterentwicklung der bisherigen Ansätze der Bewertung sprachlicher Leistungen,<br />
die sich verknüpfen lassen <strong>mit</strong> den Entwicklungen <strong>von</strong> kompetenzbezogenen Bildungsstandards.<br />
Sprachliche Leistung wird in beiden Initiativen im Sinne der hier empfohlenen<br />
Konzeption auf die sprachliche Gesamtkompetenz bezogen; Zweisprachigkeit kann daher<br />
sowohl als individuelle Bildungsvoraussetzung als auch als Bildungsziel berücksichtigt werden.<br />
Der „Europäische Referenzrahmen“ bietet ein Modell für die Entwicklung <strong>von</strong> Standards<br />
für sprachliche Bildung. Mit dem Konzept „Portfolio“ ist darüber hinaus ein weiter<br />
auszugestaltender Anfang dafür gemacht, sprachliche Fähigkeiten <strong>und</strong> Leistungen, die sich<br />
über eine Bildungsbiographie hinweg entwickeln, zu dokumentieren, wobei hier sogar eine<br />
internationale Anerkennung denkbar wäre.<br />
Während die Instrumentenentwicklung selbst auf überregionaler <strong>und</strong> institutionenübergreifender<br />
Ebene angesiedelt sein kann, sind für die Qualitätskontrolle <strong>und</strong> Qualifikation des Personals<br />
kontinuierliche Kooperationen <strong>mit</strong> Einzelinstitutionen notwendig. Hierbei liegt das<br />
Hauptaugenmerk darauf, in <strong>mit</strong>tel- bis langfristigen Überprüfungen, unter Berücksichtigung<br />
der jeweils vor Ort gegebenen Einsatzbedingungen, die Effekte des Einsatzes der Instrumente<br />
<strong>und</strong> der vorgeschlagenen Begleitmaßnahmen zu er<strong>mit</strong>teln. Durch die beteiligten Einzelinstitutionen<br />
kann auch der sozialräumliche Ansatz realisiert werden, der oben als Gr<strong>und</strong>prinzip<br />
der Maßnahmen in dieser Handlungslinie vorgeschlagen wurde. Die zu entwickelnden Ansätze<br />
beziehen sich einerseits darauf, die Familien der Kinder <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
in die diagnostischen Prozesse <strong>und</strong> die Realisierung der auf ihnen beruhenden<br />
Förderkonzepte einzubeziehen, insbesondere die Ergebnisse der Prozesse zu kommunizieren<br />
<strong>und</strong> Beratungen über <strong>Förderung</strong> gemeinsam anzustellen. Vorbilder hierfür liefern die individuellen<br />
Förderpläne, die z.B. in schwedischen <strong>und</strong> finnischen Schulen üblich sind. Zum anderen<br />
geht es um die Einbeziehung der Angebote, die sich im Umfeld einer beteiligten Instituti-<br />
121