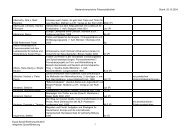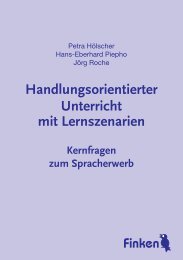Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sich die Vorstellung, Kinder <strong>und</strong> Jugendliche ohne Deutschkenntnisse könnten allein durch<br />
die Teilnahme am Regelunterricht zum Erfolg geführt werden, als Irrtum erwiesen hat. In<br />
allen B<strong>und</strong>esländern ist Förderunterricht für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>mit</strong> Migrationshintergr<strong>und</strong>,<br />
deren Deutschkenntnisse nicht ausreichend erscheinen, vorgesehen. Dieser Unterricht<br />
ist jedoch weder konzeptionell noch praktisch zufriedenstellend entwickelt, u.a. weil<br />
Forschungsdesiderate (z.B. über das Verhältnis <strong>von</strong> gesteuertem zu ungesteuertem Zweitsprachenlernen)<br />
bestehen <strong>und</strong> didaktische Konzepte kaum entwickelt worden sind (vgl. Kuhs<br />
2000). Zum Teil werden erhebliche zusätzliche Mittel für Förderunterricht bereit gestellt,<br />
deren Verwendung entweder <strong>von</strong> den Schulen autonom geregelt wird (z.B. in Form vom<br />
Doppelbesetzung, Teilungsst<strong>und</strong>en, Senkung der Klassenfrequenz) oder durch die Schulverwaltung<br />
in der Weise festgelegt wird, dass Kinder in kleinen Gruppen oder einzeln zusätzlichen<br />
Unterricht erhalten. In beiden Fällen besteht das Problem, dass bei Unterrichtsausfall<br />
oder aus sonstigen organisatorischen Gründen die Förderkapazitäten auch dazu verwendet<br />
werden, die ggf. bestehende Unterversorgung <strong>von</strong> Schulen <strong>mit</strong> Lehrerst<strong>und</strong>en oder den auf<br />
andere Weisen entstandenen Unterrichtsausfall auszugleichen. Dies ist ein Erfahrungswert,<br />
der bei Untersuchungen <strong>und</strong> Gesprächen in Schulen in den 16 B<strong>und</strong>esländern gewonnen<br />
wurde (vgl. Gogolin/ Neumann/ Reuter 2000). Dokumentationen über die tatsächliche Verwendung<br />
dieser Mittel konnten nirgends er<strong>mit</strong>telt werden. Bisher fehlen anscheinend Formen<br />
der Qualitätskontrolle für diese den Schulen zusätzlich zugewiesenen Mittel.<br />
4.4. Eingliederungsmaßnahmen<br />
Alle B<strong>und</strong>esländer sehen besondere Maßnahmen zur Eingliederung <strong>von</strong> neu aus dem Ausland<br />
zuwandernden <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> vor. Die östlichen B<strong>und</strong>esländer verzichten allerdings<br />
weitgehend auf eigene Klassen, in denen neu zugewanderte Kinder zum Unterricht in<br />
Deutsch als Zweit-/Fremdsprache zusammengefasst werden, weil die Zahl der Kinder insgesamt<br />
sehr gering ist. Eine spezielle Lösung hat Sachsen gef<strong>und</strong>en: Kern des integrativen Einsatzes<br />
ist eine Bildungsberatung, die sich an die Kinder <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> ebenso wie an deren<br />
Eltern richtet <strong>und</strong> den weiteren Bildungsweg auf der Gr<strong>und</strong>lage der bisherigen Fremdsprachenfolge<br />
– das heißt: den <strong>mit</strong>gebrachten sprachlichen Kenntnissen des Kindes entsprechend<br />
– plant. Den <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendlichen</strong> sind Betreuungslehrerinnen bzw. Betreuungslehrer<br />
zugeordnet, die das Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Die Integration in<br />
eine Regelklasse erfolgt schrittweise in drei Etappen, begleitet <strong>von</strong> der betreuenden Lehrkraft.<br />
In den ersten beiden Etappen hat der Unterricht im Fach Deutsch als Zweitsprache Vorrang,<br />
in der dritten Etappe der Regelklassenunterricht, zu dem eine begleitende <strong>Förderung</strong><br />
angeboten wird. Zu den Aufgaben der Betreuungslehrkraft gehören neben der <strong>Förderung</strong> <strong>und</strong><br />
Beratung der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sowie ihrer Eltern auch die Beratung der Einzelschule<br />
in interkulturellen Fragen. Zur Umsetzung des Konzepts, das in einem Lehrplan genau ausgearbeitet<br />
ist, gehört auch die Nutzung der Garantiefondsförderung in Form <strong>von</strong> außerschulischem<br />
Einzelunterricht oder Unterricht in Kleingruppen. Diese Lösung geht da<strong>von</strong> aus, dass<br />
zweisprachiges Aufwachsen günstige Voraussetzungen für die geistige Entwicklung eines<br />
Kindes bietet, sprachübergreifende Kompetenzen <strong>und</strong> jeden weiteren Spracherwerb fördert<br />
<strong>und</strong> Unterricht in den Muttersprachen der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler deshalb im Prozess der<br />
schulischen Integration eine wichtige Bedeutung hat. Daher wird in diesem Feld <strong>mit</strong> außerschulischen<br />
Bildungseinrichtungen kooperiert <strong>und</strong> Unterricht in verschiedenen Herkunftssprachen<br />
angeboten. So gab es im Jahr 1995/96 ein Angebot in den Sprachen Vietnamesisch,<br />
Türkisch, Arabisch, Bulgarisch <strong>und</strong> Griechisch.<br />
In den westlichen B<strong>und</strong>esländern, die seit den 1970er Jahren Erfahrungen <strong>mit</strong> der Aufnahme<br />
<strong>von</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern besitzen, die als Seiteneinsteiger aus dem Ausland in die<br />
65