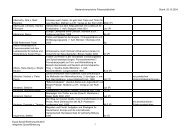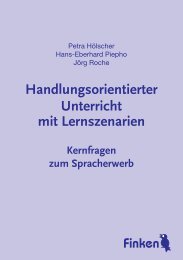Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nicht die erwartete Förderleistung erbracht habe. Eine empirische Prüfung dieser Überzeugung<br />
wurde nicht vorgenommen; dafür hätten auch die Voraussetzungen gefehlt, da das Konzept<br />
gar nicht langfristig genug <strong>und</strong> unter kontrollierten Bedingungen hatte erprobt werden<br />
können.<br />
Statt seiner Weiterentwicklung wurden auch in Nordrhein-Westfalen Maßnahmen zur Einführung<br />
frühen Fremdsprachenunterrichts etabliert. Die Achtung, <strong>Förderung</strong> <strong>und</strong> Entfaltung<br />
der sprachlichen Ressourcen, die Zugewanderte in das deutsche Bildungswesen hineinbringen,<br />
trat wieder in den Hintergr<strong>und</strong>. Insbesondere wegen der hohen Chancen zur <strong>Förderung</strong><br />
einer allgemeinen Sprachbewusstheit, die zu den Voraussetzungen für die Entwicklung einer<br />
weitreichenden Lesekompetenz gehört, könnten im Rahmen eines Innovationsprojekts die aus<br />
den 1990er Jahren vorliegenden Erfahrungen wieder aufgegriffen <strong>und</strong> weiterentwickelt werden.<br />
Hierbei würde es insbesondere darauf ankommen, die Qualifizierung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
der beteiligten Lehrkräfte einzubeziehen.<br />
4.6. Interkulturelle Aspekte im Curriculum verschiedener Fächer <strong>und</strong> im Religionsunterricht<br />
Im Hinblick auf Konzepte interkultureller Bildung <strong>und</strong> Erziehung kann nicht <strong>von</strong> einem einheitlichen<br />
Diskussionsstand gesprochen werden, auch wenn sich die verschiedenen theoretischen<br />
Positionen in den letzten Jahren einander angenähert haben. Nach Auernheimer (2003)<br />
besteht inzwischen weitgehend Konsens über einige Gr<strong>und</strong>positionen: Der Kulturbegriff sei<br />
nicht essentialistisch zu verstehen, sondern als historisch gewordene Konstruktion, deren<br />
symbolische Ordnung auch die jeweiligen gesellschaftlichen Machtverhältnisse <strong>von</strong> Wirklichkeit<br />
einschließe. Es müsse also der Benachteiligung <strong>von</strong> Minderheiten Beachtung geschenkt<br />
werden <strong>und</strong> rassistischen Diskursen entgegengewirkt werden. Weiterhin bestehe Einigkeit<br />
über das Ziel, durch Selbstreflexion die eigene Kulturgeb<strong>und</strong>enheit zu erkennen.<br />
Auch kulturelle Identität sei nicht statisch <strong>und</strong> eindeutig, sondern vorläufig <strong>und</strong> „hybrid“ <strong>und</strong><br />
unterliege einer permanenten Dynamik aufgr<strong>und</strong> individueller wie gesellschaftlicher Gestaltungsprozesse<br />
(vgl. Roth 2002).<br />
Von dieser in der erziehungs- <strong>und</strong> sozialwissenschaftlichen Diskussion geführten Debatte ist<br />
die pädagogischen Praxis zu unterscheiden. Soweit sie die Vorschul- <strong>und</strong> Elementarpädagogik<br />
betrifft, wurden bereits seit Anfang der 1980er Jahre Projekte durchgeführt, die hauptsächlich<br />
auf einer inhaltlichen Ebene – unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit – interkulturelle<br />
Ideen verwirklichen wollten. In der Folge wurde der „Situationsansatz“ entwickelt<br />
<strong>und</strong> interkulturell neu bestimmt.<br />
Für die Praxisebene der Schule sind einerseits die Schulgesetze <strong>und</strong> Erlasse bedeutend, andererseits<br />
die Lehrpläne <strong>und</strong> Schulbücher, <strong>von</strong> denen der pädagogische Alltag mehr oder weniger<br />
gesteuert wird. Umgekehrt schlagen sich darin die Vorstellungen über interkulturelle Bildung<br />
nieder, so dass sie sich als Analysegegenstand für die curriculare Umsetzung dieser<br />
Ziele eignen. Erstmalig explizit haben sich 1996 die Länder der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
darauf verständigt, interkulturelle Aspekte nicht als Zusatzaufgabe, sondern als Zielsetzung<br />
<strong>von</strong> allgemeiner Bedeutung im Bildungsprozess zu etablieren. Mit der KMK-Empfehlung<br />
„Interkulturelle Bildung <strong>und</strong> Erziehung in der Schule“ haben Leitvorstellungen <strong>von</strong> Interkulturalität<br />
Eingang in die allgemeinen Ziele, denen der Bildungsprozess nachstreben soll, gef<strong>und</strong>en.<br />
In der Richtlinie wird betont, dass es um die „Wahrnehmung <strong>und</strong> Akzeptanz <strong>von</strong><br />
Differenz“ gehen soll, die <strong>mit</strong> strukturellen <strong>und</strong> inhaltlichen Veränderungsprozessen im Bildungswesen<br />
angestrebt werden sollen. Das Anliegen interkultureller Bildung <strong>und</strong> Erziehung<br />
richtet sich in diesem Verständnis nicht allein auf die spezifische Zielgruppe zugewanderter<br />
74