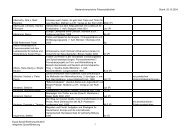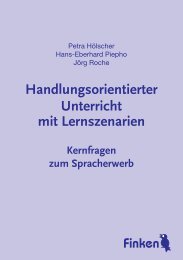Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der Erstausbildung gegeben.<br />
(4) Berücksichtigung <strong>und</strong> <strong>Förderung</strong> der Zweisprachigkeit<br />
Die kontinuierliche <strong>und</strong> im dargestellten Sinne systematische <strong>Förderung</strong> der Sprachkenntnisse<br />
zweisprachig Aufwachsender kann sich nicht <strong>mit</strong> der <strong>Förderung</strong> eines Teils ihrer sprachlichen<br />
Fähigkeiten begnügen, sondern sollte die sprachliche Gesamtfähigkeit betreffen – also ihre<br />
beiden Sprachen. Die vorliegenden internationalen Untersuchungen belegen, dass Modelle, in<br />
denen zweisprachig lebende Kinder in beiden Sprachen gefördert werden, denen, die sich nur<br />
einer der beiden Sprachen zuwenden, überlegen sind.<br />
Hieraus folgt zweierlei:<br />
- Zum einen muss bei der <strong>Förderung</strong> der deutschen Sprache die Voraussetzung Zweisprachigkeit<br />
<strong>mit</strong>bedacht werden. Die <strong>Förderung</strong> im Elementarbereich <strong>und</strong> in der Schule muss<br />
also methodisch <strong>und</strong> inhaltlich anders gestaltet sein, als dies bei einsprachig Aufgewachsenen<br />
der Fall ist. Anhaltspunkte für die Gestaltung liegen in Konzepten der Zweitsprachförderung<br />
vor, die unter dem Gesichtspunkt, dass sie eine Bildungsbiografie begleiten<br />
sollen, weiterentwickelt werden müssen.<br />
- Zum anderen ist es erfolgversprechend, zweisprachig lebende Kinder schon im Elementarbereich<br />
in beiden Sprachen zu fördern. Insbesondere aber sollten sie in beiden Sprachen<br />
Zugang zur Schrift erhalten, <strong>und</strong> zwar in aufeinander abgestimmtem <strong>und</strong> ergänzenden<br />
Unterricht.<br />
Vorbildliche Praxis, in der diese Bedingungen erfüllt werden, ist in Deutschland rar (vgl. hierzu<br />
Kap. 4 <strong>und</strong> 5). Bekannt sind Beispiele <strong>von</strong> Kindergärten <strong>und</strong> Schulen, in denen Zweisprachigkeit<br />
bei der <strong>Förderung</strong> des Deutschen zu berücksichtigt <strong>und</strong>, wenn auch in bescheidener Weise,<br />
weiterentwickelt wird. Für die eigentlich konsequente <strong>Förderung</strong> der Zweisprachigkeit durch<br />
Unterweisung in beiden Sprachen gibt es aber hierzulande nur vereinzelte Beispiele, etwa<br />
Ansätze der bilingualen Literalisierung in Gr<strong>und</strong>schulen, wie sie oben vorgestellt wurden. Hier<br />
ist also Entwicklungsarbeit zu leisten, insbesondere im Hinblick auf flexible Modelle, <strong>mit</strong> denen<br />
auf unterschiedliche Gruppenkonstellationen eingegangen werden kann. Für diese Arbeit kann<br />
man sich an internationalen Vorbildern – z.B. an Schweden oder den Niederlanden – orientieren.<br />
In diesen beiden <strong>und</strong> anderen Staaten gibt es auch Vorbilder für organisatorisch flexible Konzepte<br />
eines gleichwohl qualitativ hochwertigen Unterrichts der Familiensprachen, die aufgreifenswert<br />
sind.<br />
(5) Berücksichtigung mobiler Lebensweisen<br />
Mit der Heterogenität in der Schülerschaft <strong>und</strong> der Zunahme mobiler Lebensweisen wird das<br />
deutsche Schulsystem dauerhaft rechnen müssen – zumal angesichts der bevorstehenden Erweiterung<br />
der EU. Daher sollten die Regeleinrichtungen des deutschen Bildungssystems Vorkehrungen<br />
enthalten, <strong>mit</strong> denen flexibel <strong>und</strong> angemessen auf diesen Sachverhalt reagiert werden kann.<br />
Zu den dafür notwendigen Voraussetzungen gehören vor allem<br />
- eine Bildungsberichterstattung, durch die die Entwicklungen in der Schülerschaft zeitnah<br />
<strong>und</strong> realistisch abgebildet werden, als Gr<strong>und</strong>lage für Planungsentscheidungen;<br />
- Modelle der Kooperation zwischen Institutionen – insbesondere zwischen der Schule <strong>und</strong><br />
außerschulischen Einrichtungen sowie am Übergang in das Berufsleben – , <strong>mit</strong> denen auf<br />
mobilitätsbedingte Bedürfnisse der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler flexibel <strong>und</strong> sachgerecht<br />
reagiert werden kann. Hierzu gehören z.B. Partnerschaften zwischen Institutionen in ver-<br />
61