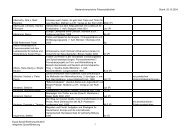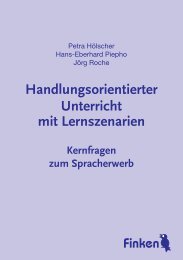Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erstspracherwerb bezeichnet. Jenseits aller Kontroversen, die in der Forschung über diese sehr<br />
bedeutende Phase des Spracherwerbs ausgetragen wurden – erinnert sei hier nur als Beispiel an<br />
die in den 1960er <strong>und</strong> 1970er Jahren ausgetragene „Anlage-Umwelt-Kontroverse“ (vgl.<br />
Miller/Weißenborn 1998) – ist inzwischen unumstritten, dass sich Spracherwerb als Prozess der<br />
Wechselwirkung zwischen angeborenen Voraussetzungen <strong>und</strong> sozialen Einflüssen vollzieht.<br />
Jedes Kind bringt bei seiner Geburt das gesamte Rüstzeug <strong>mit</strong>, das es zum Spracherwerb benötigt<br />
(sieht man <strong>von</strong> den Ausnahmefällen spezieller Erkrankungen einmal ab). Da<strong>mit</strong> sich ein<br />
Kind aber konkrete Sprache aneignen kann, muss es in einen intensiven Kontakt <strong>mit</strong> den Menschen<br />
<strong>und</strong> Dingen in seiner Umwelt treten.<br />
Zunächst gewinnt das Kind seine Sprache primär <strong>von</strong> den Personen seiner engsten Umgebung,<br />
also der Familie im weiteren Sinne. Mit zunehmender körperlicher <strong>und</strong> geistiger Entwicklung<br />
macht es sich die außerfamiliale Lebenswelt <strong>und</strong> die weitere Objektwelt für die Sprachaneignung<br />
zunutze. Sprachaneignung, zunehmende physische <strong>und</strong> intellektuelle Mobilität <strong>und</strong> der weitere<br />
Ausbau sprachlicher Möglichkeiten stehen dabei in einem komplexen Wechselverhältnis. Mit<br />
dem Gewinn an Unabhängigkeit vom engsten familialen Kontext geht die Aneignung immer<br />
weiter entfalteter sprachlicher Mittel einher <strong>und</strong> <strong>mit</strong> der Komplexität des zur Verfügung stehenden<br />
Sprachvermögens wächst die Unabhängigkeit des Kindes – also erneut seine Möglichkeit,<br />
sich einen immer größeren Ausschnitt seiner Umwelt für die Sprachaneignung zu erschließen.<br />
Psycholinguistische Forschung belegt, dass sich das Kind durch sein praktisches Tun <strong>und</strong> seine<br />
geistigen Handlungen die eigene nervliche Organisation letztlich selbst herstellt. Die angeborenen<br />
Dispositionen zum Aufbau intellektueller <strong>und</strong> sprachlicher Kompetenz entwickeln sich also<br />
entscheidend durch die eigenen Aktivitäten des Kindes.<br />
Im Verlauf der ersten Sprachaneignung kommt es zum zunehmenden Besitz <strong>von</strong> syntaktisch<br />
gegliederter Rede; zugleich wächst die Fähigkeit, Bedeutungen zu differenzieren. In dieser Phase<br />
lässt sich das Wechselverhältnis <strong>von</strong> Anlage, Umwelt <strong>und</strong> eigenen Aktivitäten des Kindes gut<br />
beobachten. In seiner allerersten Lebenspraxis ist das Kind auf den direkten Zusammenhang <strong>von</strong><br />
Verständigungs<strong>mit</strong>teln <strong>und</strong> ihren Bedeutungen angewiesen. In dem Maße aber, in dem das Kind<br />
an Beweglichkeit gewinnt, wächst auch seine Fähigkeit, vom un<strong>mit</strong>telbar gegebenen, eindeutigen<br />
Kontext einer Äußerung zu abstrahieren. Es erfährt <strong>und</strong> benötigt nun auch komplexere Äußerungsformen,<br />
die ihm helfen, Situationen, Gefühle oder Handlungen zu deuten <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
In diesem Prozess vollzieht sich nicht nur der Zugewinn an sprachlichen Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Mitteln im engeren Sinne. Vielmehr entwickelt das Kind allmählich auch das System an kulturellen<br />
<strong>und</strong> sozialen Regeln, Kontextwissen <strong>und</strong> Vorverständnissen, das ihm die Möglichkeit der<br />
Teilhabe an den Konventionen der Kultur- <strong>und</strong> Sprachgemeinschaft verschafft, in die es hineingeboren<br />
wurde.<br />
Die Spracherwerbsforschung hat gezeigt, dass diese generellen Gr<strong>und</strong>lagen zu deutlichen<br />
Differenzen im Ergebnis der Sprachaneignung einsprachig aufwachsender <strong>und</strong> zweisprachig<br />
aufwachsender Kinder führen. Beim einsprachig aufwachsenden Kind geschieht der Prozess der<br />
Sprachaneignung in einer im weiteren Sinne sprachhomogenen Situation. Zwar gibt es auch hier<br />
Verschiedenheit im sprachlichen Umfeld, beispielsweise durch unterschiedliche persönliche,<br />
soziale oder dialektale Varianten der Familiensprache. Auch erlebt das Kind eine Bandbreite <strong>von</strong><br />
Stilen, Lebenslagen, Traditionen in seiner Umgebung. Dennoch weist das sprachliche Repertoire<br />
im weiteren Sinne, dessen Einfluss dieses Kind genießt, einen sehr großen Bestand an Gr<strong>und</strong>gemeinsamkeiten<br />
auf. Daher können sich einsprachig aufwachsende Kinder vergleichsweise<br />
mühelos in ihrer sprachlichen Umwelt für die eigene Sprachaneignung bedienen. Beim Kind, das<br />
in einer Dialektumgebung aufwächst, kann - je nach Grad der Distanz zwischen Dialekt <strong>und</strong><br />
Standardsprache - tendenziell auch <strong>von</strong> zweisprachigem Aufwachsen die Rede sein.<br />
40