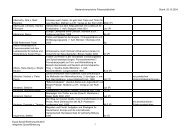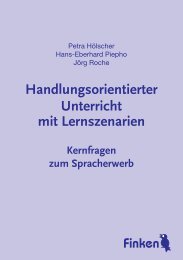Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Herkunft, sollen gleichermaßen beachtet <strong>und</strong> gefördert werden, ihre teilweise unterschiedlichen<br />
Interessen <strong>und</strong> Fähigkeiten sollen in Unterricht <strong>und</strong> Schulleben gleichermaßen<br />
zum Zuge kommen“. In den formulierten Standards für die einzelnen Fächer wird aber auf<br />
sprachliche Heterogenität bzw. Zweisprachigkeit nicht weiter eingegangen. Gefordert wird<br />
Allgemeines, z.B. dass Bildungsstandards präzise, aber auch offen formuliert sein müssten,<br />
über das hinausgehen müssten, was durch Lernkontrollen überprüfbar sei, <strong>und</strong> die Bedingungen,<br />
unter denen Leistungen zu erbringen seien, <strong>mit</strong> bedacht werden müssten. Dieser letzte<br />
Punkt böte Anknüpfungsmöglichkeiten für die Berücksichtigung sprachlicher Heterogenität.<br />
4.7.3. Lehrerbildung<br />
Mit der stärkeren Berücksichtigung der sprachlichen Voraussetzungen, <strong>mit</strong> denen Kinder in<br />
die Schule eintreten, <strong>und</strong> ihrer sprachlichen <strong>Förderung</strong> im Elementarbereich, ist auch die Erzieherinnenfortbildung<br />
in den Fokus der Betrachtung gerückt. In den 1980er Jahren hatte es<br />
schon einmal eine erhöhte Aufmerksamkeit für interkulturelle <strong>und</strong> zweisprachige Elementarerziehung<br />
gegeben (Bayern: Staatsinstitut für Frühpädagogik, Fthenakis „Zweisprachigkeit<br />
im Kindergarten“, Berlin: Jürgen Zimmer, „Sozialisationshilfen für ausländische Kinder im<br />
Kindergarten“, div. Projekte der Bosch-Stiftung). In diesem Zusammenhang wurden neben<br />
konzeptionellen Entwicklungen <strong>und</strong> Materialerstellung auch Fortbildungsangebote für Erzieherinnen<br />
<strong>und</strong> Erzieher entwickelt. Dennoch hat die Frage interkultureller Bildung in ihren<br />
sprachlichen Aspekten kaum Einzug in die Erzieherinnenausbildung gehalten. Fachschulcurricula,<br />
die den Umgang <strong>mit</strong> Zweisprachigkeit <strong>und</strong> die sprachliche <strong>Förderung</strong> <strong>von</strong> Migrantenkindern<br />
im Elementarbereich thematisieren, sind dem Gutachterteam nicht bekannt. In der<br />
gegenwärtigen Situation wird daher erneut auf Fortbildung gesetzt, wie im Kapitel I.5. dargestellt<br />
wird. Hinzuweisen ist jedoch auf eine Maßnahme in Hamburg, die zunächst als Modellprojekt<br />
„Erzieherinnenausbildung für Einwanderinnen“ erprobt, inzwischen zu einem<br />
Regelangebot für Migrantinnen geworden ist. In diesem Weiterbildungsangebot werden kontinuierlich<br />
zugewanderte Frauen, die mindestens fünf Jahre eine Schule besucht haben <strong>und</strong><br />
über Deutschkenntnisse verfügen, zu Erzieherinnen ausgebildet, während sie bereits in einer<br />
Kindertagesstätte arbeiten. Aus dieser Erfahrung schöpfend, hat die anbietende Fachschule<br />
ein Konzept für einen Schwerpunkt „interkulturelle Erziehung“ innerhalb ihrer Regelausbildung<br />
<strong>von</strong> Erzieherinnen entwickelt.<br />
In der Lehreraus- <strong>und</strong> -fortbildung wurde bereits zu Beginn der 1970er Jahre auf die <strong>mit</strong> der<br />
Arbeitsmigration verb<strong>und</strong>enen Herausforderungen an Bildung <strong>und</strong> Erziehung reagiert. Erste<br />
Studiengänge an Universitäten (Bremen, Essen, Hamburg, Landau/Pfalz, Münster, Oldenburg)<br />
wurden ab 1976 in Form <strong>von</strong> Ergänzungsstudiengängen eingerichtet, die z.T. heute<br />
noch bestehen. Landesweite Programme zur Lehrerfortbildung wurden in den 1980er Jahren<br />
durchgeführt; sie bezogen sich – meist in enger Verbindung <strong>mit</strong> der Entwicklung <strong>von</strong> Unterrichtsmaterialien<br />
– im Schwerpunkt auf den Bereich der sprachlichen Bildung, meist auf<br />
Deutsch als Zweitsprache. In solchen B<strong>und</strong>esländern, die herkunftssprachlichen Unterricht in<br />
eigener Verantwortung anbieten, war auch dieser Bereich eingeschlossen (am intensivsten in<br />
Nordrhein-Westfalen <strong>und</strong> Hessen).<br />
Gegenwärtig ist jedoch keineswegs gesichert, dass alle angehenden Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer<br />
während ihrer Ausbildung die Bedeutung <strong>von</strong> sprachlicher <strong>und</strong> kultureller Heterogenität für<br />
Bildungsprozesse kennen lernen <strong>und</strong> Qualifikationen zum Umgang <strong>mit</strong> Heterogenität erwerben.<br />
In einigen B<strong>und</strong>esländern sind entsprechende Themen in die Lehrerprüfungsordnungen<br />
aufgenommen worden, z.T. aber nicht für Lehrkräfte an Gymnasien (z.B. in Baden-<br />
Württemberg, Bayern). Ein verpflichtendes Angebot „Arbeit <strong>mit</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
anderer Herkunftssprachen“ (2 SWS) besteht an den Berliner Hochschulen; Lehramtsstudie-<br />
86