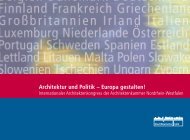5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Was ist Identität?<br />
Identität ist die Antwort auf die Frage, wer jemand ist. Diese<br />
Antwort kann durch eine Person, eine Gruppe, eine Nation,<br />
eine ganze Zivilisation gegeben werden. Tatsächlich ist Identität<br />
eine kulturelle Notwendigkeit für jede soziale Einheit<br />
im menschlichen Zusammenleben. Sie ist ein Gefühl und<br />
eine Überzeugung von Zugehörigkeit, von Zusammengehörigkeit;<br />
gleichzeitig ist diese Zugehörigkeit eine Unterscheidung<br />
von anderen. Identität bedeutet nicht unbedingt,<br />
uniform zu sein. Anstatt von Uniformität sollte man vielmehr<br />
von Gemeinschaftlichkeit mit und Verschiedenheit zu<br />
anderen sprechen. Sie ist eine Art verinnerlichter Kohäsion –<br />
oder Kohärenz – in sozialen Beziehungen, eine Frage von<br />
Subjektivität.<br />
Wandel ist eine elementare Herausforderung für Identitätsbildung,<br />
denn Wandel widerspricht dem grundlegenden<br />
menschlichen Bedürfnis nach Beständigkeit und sozialer<br />
Zugehörigkeit (Müller 1987). Deshalb befassen sich Prozesse<br />
der Identitätsbildung immer mit „Zeit“. Sie versuchen, Zeit<br />
eine Form zu geben, in der Identität überleben, bestehen<br />
oder sich entwickeln kann. Das menschliche Selbst erhält<br />
seine Gestalt in einem komplexen Wechselspiel aus Erinnerung<br />
an die Vergangenheit und Projektion in die Zukunft,<br />
indem Vergangenheit im Hinblick auf das Bedürfnis nach<br />
Fortsetzung interpretiert wird.<br />
Historische Identität ist eine äußerst elaborierte Form dieser<br />
gewissermaßen „zeitlichen Gestalt“ des menschlichen<br />
Selbst. Die kulturelle Strategie, diese zeitliche Gestalt des<br />
menschlichen Selbst hervorzubringen, besteht darin, eine<br />
Geschichte zu erzählen. Geschichten, die die Identität der<br />
Menschen in einer zeitlich erweiterten Perspektive erzählen,<br />
bezeichnet man als „Meta-Erzählungen“. Starke Erzählungen,<br />
die die historische Identität der Menschen repräsentieren,<br />
sind aber genauso zerbrechlich wie die menschliche<br />
Identität selbst, sie sind gleichermaßen vom Wandel der<br />
Lebensumstände bedroht und herausgefordert.<br />
Das Wechselspiel zwischen Tradition und Identität<br />
Tradition ist die grundlegende Form, durch die Identität geprägt wird. Die<br />
Menschen werden in ein bestehendes kulturelles System hineingeboren, das<br />
bestimmt, wer sie sind. Und sie haben diese Vorausbedingungen in ihren<br />
mentalen Körpern verinnerlicht, in ihrem Selbst-Sein – als Vermittlungsfeld<br />
zwischen ihren persönlichen Interessen und Zielen auf der einen und den<br />
gesellschaftlichen Ansprüchen und Pflichten auf der anderen Seite. Ohne<br />
eine solche traditionelle Grundlage gibt es keine Identität. Tradition stellt<br />
Identität als selbstverständlich dar, als feste Größe in einer sich verändernden<br />
Welt menschlicher Beziehungen. Um diese Dauerhaftigkeit und Stabilität<br />
des Eigenen geht es auf allen Ebenen, bei denen Tradition eine Rolle im<br />
menschlichen Leben spielt.<br />
(1) Auf der „elementaren Ebene der unbewussten Selbstverständlichkeit“<br />
erhält das menschliche Selbst seine erste Form von Selbstwahrnehmung<br />
und Selbstachtung und die ersten Überzeugungen über Zusammengehörigkeit<br />
und Verschiedenheit zu anderen.<br />
(2) Diese Grundmuster geraten auf der zweiten Ebene in „eine kommunikative<br />
Bewegung“, wenn die Menschen ihre Selbst-Erfahrung interpretieren<br />
müssen – also die Art und Weise, wie ihnen andere begegnet sind und wie<br />
sie mit ihrem Konzept ihres Selbst anderen begegnen.<br />
(3) Auf der dritten Ebene, dort wo „Traditionen explizit thematisiert“ werden,<br />
wird Tradition zum Gegenstand mehr oder weniger systematischer Reflektion.<br />
Die stärkste Form von Kommunikation ist hier die Frage „Wer bin ich?“<br />
oder „Wer sind wir?“– unausweichliche Fragen, weil das menschliche Leben<br />
von Zeit zu Zeit mit einer Situation konfrontiert wird, in der die Stabilität<br />
bestehender Identitätskonzepte radikal herausgefordert, angegriffen und<br />
gefährdet wird.<br />
(4) Auf der vierten Ebene, auf der „obligatorische Modelle und Paradigmen<br />
historischer Identität“ sich etabliert haben, wird Tradition permanent kultiviert,<br />
heraufbeschworen und legitimiert. Dort werden die Ursprünge nach<br />
wie vor gültiger Lebensweisen zelebriert. <strong>Jahre</strong>stage und Jubiläen bestätigen<br />
und festigen die gemeinsamen Wertesysteme und Modelle von Selbst-<br />
Verständnis und historischer Repräsentation.<br />
Meta-Erzählungen und Grundsatzdiskurse über historische Identität finden<br />
auf all diesen Ebenen statt, sie werden jeweils an neue Situationen angepasst,<br />
die durch neue Erfahrungen und Erwartungen gekennzeichnet sind.<br />
Hier ist traditionelle Identität eine Frage von zeitlichem Wandel. Gerade<br />
wenn die Umstände sich ändern, muss sich auch traditionelle Identität verändern,<br />
um die Vorstellung von Stabilität und eine Kontinuität von Verpflichtung,<br />
die sich aus traditioneller Identität ergibt, aufrechterhalten zu<br />
können.<br />
Modernität steht in einem grundsätzlichen Gegensatz zur Idee der unveränderbaren<br />
Gültigkeit von Lebensweisen. Sie betont den Wandel als Voraussetzung<br />
für Kontinuität. Die Kategorie des Fortschritts, die typisch für das<br />
moderne historische Denken und seine Logik ist, widerspricht der Art, wie<br />
historische Identität durch Tradition geformt wird. Aber dennoch ist die<br />
Überzeugung, dass sich die Grundlagen der eigenen Identität nicht verändern,<br />
sondern stabil bleiben, ein machtvolles Element moderner historischer<br />
Kultur. So erhält Tradition ihre spezifischen modernen Formen, z.B. eine<br />
innere zeitliche Dynamik, wenn es um die Darstellung von Stabilität und<br />
Kontinuität geht (Assmann, A. 1999).<br />
111




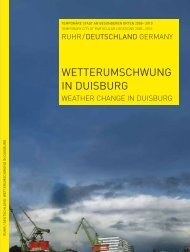
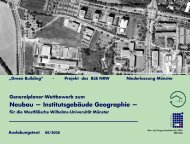





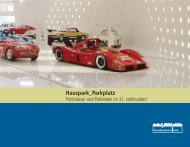




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)