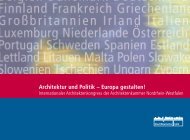5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Phänomen 2: privat – öffentlich, öffentlich – privat<br />
Die Ausbreitung von außerfamiliären und temporären<br />
Gemeinschaften hat umgekehrt das Private verändert, das<br />
nun auch kollektive Formen annehmen kann. In den Privatraum<br />
dringt elektronische Öffentlichkeit, die Privates als<br />
öffentliche Angelegenheit inszeniert. Intime Probleme<br />
erscheinen am Bildschirm als kollektives Schicksal, das –<br />
medial zubereitet – sich zum emotionalen Globalkitt verdichtet.<br />
Der privat-öffentlichen stehen öffentlich-private Formen<br />
elektronischer Öffentlichkeit gegenüber. Ein Beispiel dafür<br />
ist eine Fußballsendung in Italien, die als Alternative zum<br />
Pay-TV entstanden ist. Sie hat unerwartet hohe Einschaltquoten<br />
eingespielt, was man zunächst auf die unentgeltliche<br />
Übertragung des Spiels zurückgeführt hat. Doch der<br />
eigentliche Grund war ein anderer.<br />
Bei der sonntäglichen Live-Übertragung sieht man nicht das<br />
Spiel, sondern einen aufgeregt kommentierenden, permanent<br />
schreienden Reporter, der – immer nahe am Herzinfarkt<br />
– von einer blonden Assistentin regelmäßig zu besänftigen<br />
versucht wird. Die wirkliche Attraktion der Sendung ist<br />
die Herausforderung, eigene Deutungsarbeit leisten zu müssen<br />
bzw. dies zu dürfen. Die Rede über das Spiel kann nämlich<br />
wichtiger sein als das Spiel selbst. Das Unsichtbare lässt<br />
viele Deutungen zu, so dass Spiele im Spiel entstehen.<br />
Im Zusammenhang mit Literatur und Kunst haben Roland<br />
Barthes, Michel Foucault und Umberto Eco schon früh auf<br />
den Rollenwechsel zwischen Autor und Leser hingewiesen.<br />
Die postavantgardistische These besteht darin, dass ein<br />
Werk erst durch Deutung vollendet wird. Ähnliches meint<br />
der gängige Begriff „Interaktion“. Er bezeichnet in kommunikativer<br />
wie kultureller Hinsicht ein strukturierendes und<br />
vor allem konstitutives Element von Öffentlichkeit, nicht nur<br />
im Fußball, sondern auch in der modernen Kunst, in der<br />
digitalen Spielewelt, nahezu überall.<br />
Phänomen 3: Reproduktionen von Reproduktionen<br />
Die Medialisierung der Alltagswelt schafft auch neue Verhältnisse zu den<br />
Räumen und zu den Landschaften. Was ist ein wirklicher Raum, was ein fiktiver,<br />
was ein virtueller? Welche Landschaft ist natürlich, welche künstlich?<br />
Auf den Werbetafeln von Marlboro sind die Rocky Mountains abgebildet.<br />
Es handelt sich dabei um die atmosphärische Nachahmung einer Filmszene<br />
aus „Wyatt Earp“, also um die Reproduktion einer Reproduktion.<br />
In den 1990er <strong>Jahre</strong>n ist auch ein Architekturgenre entstanden, das sich an<br />
den Arbeitsweisen der globalen Werbebranche orientiert: Die mediale Wirkung<br />
ist wichtiger als das reale Objekt. Das Guggenheimmuseum in Bilbao<br />
war 1997 das erste Beispiel dieses Genres. Das Gebäude wurde als eine einzigartige<br />
Form für den globalen Bildschirm entworfen, als medialer „Oberflächenknall”<br />
und heiteres Architekturerlebnis.<br />
Was für die Werbung und ihre Wirkmechanismen gelten mag, trifft für die<br />
Architektur allerdings nur bedingt zu: Die Ökonomie der Aufmerksamkeit<br />
hat dort ihre eigenen Gesetze. Die Entmaterialisierung von Objekten und<br />
Produkten suggeriert zwar, dass alles machbar und möglich ist, auch eine<br />
Architektur mit Voodoo-Zauber. In Wirklichkeit verschleißt sich die Suggestivkraft<br />
aber sehr rasch, so wie die Bilder, welche die Medien durchfluten.<br />
Eine Wiederholung ist nicht möglich; der Zwang, immer das Neue zu finden,<br />
das sich zugleich zerstört, ist eben auch eine (Medien-)falle. In sie ist die<br />
globale Architektur hineingefallen und darin zur „Wurlitzerorgel der Form“<br />
geworden. Für das Tempo der Bilder und die mediale Entmaterialisierung,<br />
die eben auch wörtlich gemeint sind, ist die Architektur offenbar ein ungeeignetes,<br />
viel zu träges Medium.<br />
47




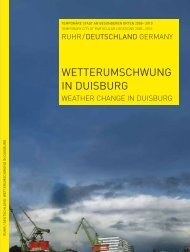
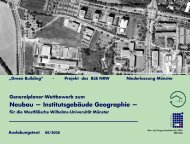





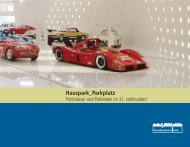




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)