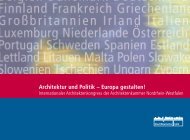5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ulrich Hatzfeld<br />
Mit Baukultur umzugehen heißt, Widersprüche produktiv zu machen<br />
Es gibt in der Tat nicht wenige, die Baukultur und Gestaltqualität mit Luxus<br />
und Schöngeisterei assoziieren: ein „Überbauthema“, das man in guten Zeiten<br />
im Feuilleton vertiefen könnte. Aber spätestens dann, wenn es konkret<br />
wird, wenn es um wirtschaftsnahe Planungsverfahren und zügiges Bauen<br />
geht, werde Baukultur zum Kostenfaktor und Investitionshemmnis. In der<br />
nun seit <strong>Jahre</strong>n anhaltenden Phase, in der die Bauwirtschaft von einer Krise<br />
in die nächste geworfen werde, komme im Zweifelsfall „erst das Bauen,<br />
dann die Kultur“. Allzu viel und allzu teure Baukultur passe nun einmal<br />
nicht in eine Zeit, in der primär Arbeitsplätze geschaffen, das Sozialsystem<br />
gesichert und das Gesundheitswesen neu geordnet werden müsse.<br />
Für andere hingegen ist Baukultur fast so etwas wie eine Überlebensstrategie,<br />
eine Insel der Hoffnung in einem Meer der Perspektivlosigkeit. Schon<br />
die Vergangenheit habe – so die Argumentation – gezeigt, dass die Logik<br />
von Rationalisierung und Massenproduktion allein nicht trage. Wenn die<br />
Nachfrage nach Massenware auch demographisch bedingt nachlasse,<br />
müsse man die Strategie des „immer mehr desselben“ und des „immer<br />
kostengünstiger“ modifizieren. Wie in der übrigen Wirtschaft liege auch die<br />
Zukunft des Bauens in Deutschland in einer „diversifizierten Qualitätsproduktion“;<br />
konkret meine dies neue Produkte, ingenieurwissenschaftliche<br />
Innovationen und vor allem neue architektonische Gestaltqualitäten.<br />
Nur „gutes Bauen“ schaffe sichere Arbeit, eröffne neue Märkte und bilde<br />
die Grundlage für den Export von Architektur- und Ingenieurleistungen.<br />
Eine dritte Gruppe betont den Charakter von Baukultur als künstlerischkulturelle<br />
Aufgabe. Die öffentliche Hand sei für die Erhaltung des Kulturgutes<br />
Stadt und dessen Weitergabe an die nachfolgenden Generationen<br />
verantwortlich. Die Erhaltung des kulturellen Erbes, also Denkmalschutz und<br />
-pflege, dürften sich nun einmal nicht der Logik einer immer kurzatmigeren<br />
Immobilienverwertung unterordnen. Ein Kulturstaat sei eben auch ein Baukulturstaat.<br />
Dasselbe gelte für die künstlerische Sicht auf die Stadt: Architektur<br />
als älteste und öffentlichste aller Künste könne nicht allein mit dem<br />
kalten Maßstab der Rentabilität gemessen werden.<br />
6<br />
Gute Zeiten und schlechte Zeiten<br />
für Baukultur<br />
Die <strong>Landesinitiative</strong> <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong><br />
Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Sichtweisen auf das<br />
Thema Baukultur sehr unterscheiden, spricht sich kaum<br />
jemand offen gegen baukulturelle Kriterien wie die Bewahrung<br />
des historischen Erbes, den Anspruch auf Schönheit<br />
oder die Forderung nach gestalterischer Qualität aus. Das<br />
gilt selbst für die Vertreter einer harten Investitionsstrategie,<br />
insbesondere dann, wenn Architektur und Gestaltung die<br />
Vermarktbarkeit von Investitionsobjekten verbessern. Diese<br />
generelle Zustimmung ist auf der anderen Seite vermutlich<br />
eines der größten Probleme für die Anhebung des baukulturellen<br />
Niveaus: Die Forderung nach mehr Baukultur hat –<br />
zumindest so lange, wie sie in dieser erhabenen Allgemeinheit<br />
bleibt – keine erkennbaren Feinde. Erst wenn Baukultur<br />
konkret wird, wenn sie sich gegen schnelles Bauen oder<br />
gegen allzu glatte Planungsverfahren wendet, kostet Baukultur<br />
Aufwand: Zeit, Mühe und Geld. Und nahezu regelmäßig<br />
werden dann Strategien zur Beschleunigung und zur<br />
Senkung von Kosten und Standards wirksam. Und leider<br />
muss man dann „in diesem Einzelfall“ und „mit Bedauern“<br />
auf baukulturell qualifizierende Verfahren verzichten.<br />
Zusätzlich wird das allzu leicht formulierte Bekenntnis zu<br />
Baukultur dadurch erleichtert, dass es keine allgemein anerkannte<br />
Abgrenzung und erst recht keine numerischen Kriterien<br />
für diesen Begriff gibt. Wenn man etwa feststellt, dass<br />
Baukultur in erster Linie aus Diskussionsbereitschaft und<br />
wachem Bewusstsein für die Umwelt besteht, ist das zwar<br />
richtig; aber in der sich anschließenden Diskussion verschwimmen<br />
dann nicht selten die Grenzen zwischen Baukultur<br />
und Baulyrik. Die Frage, was Baukultur ist und was<br />
nicht, ist eben nicht nur zeitabhängig, sondern auch regional<br />
und interkulturell sehr unterschiedlich zu beantworten.<br />
Letztendlich beschreibt Baukultur eine besondere Haltung<br />
gegenüber dem Planen und Bauen. Als solche – so formuliert<br />
es das Memorandum <strong>StadtBauKultur</strong> <strong>NRW</strong> – „entzieht<br />
sich Baukultur schlichter empirischer Messbarkeit oder Operationalität.<br />
Denn sie ist<br />
- weniger ein Produkt als ein Anspruch und<br />
- weniger ein Zustand als ein Prozess.




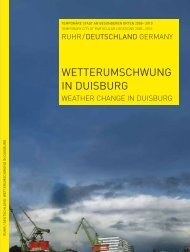
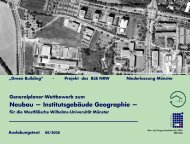





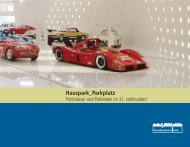




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)