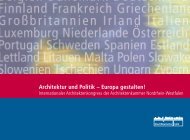5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sträucher „bevölkern“ den Ort. Zugleich verspricht das Zitat<br />
vom Platz eine „gefühlte“ Öffentlichkeit und verheißt gutes,<br />
kulturell reichhaltiges städtisches Leben, ganz egal, wie<br />
lebendig die Öffentlichkeit in den angrenzenden Stadtquartieren<br />
tatsächlich ist.<br />
Solche Hybride sind im übertragenen Sinn transparente<br />
Gebilde und lassen unterschiedliche Lesarten zu. Vordergründig<br />
betrachtet scheinen sich zwei traditionell positiv<br />
besetzte städtische Freiraumelemente auf verblüffend einfache<br />
Weise miteinander zu verbinden. Vielleicht tauchen<br />
sie gerade deshalb seit einigen <strong>Jahre</strong>n in verschiedenen<br />
Variationen auf: Der Parc del Clot von Dani Freixes und<br />
Vicente Miranda in Barcelona, die Place de la Bourse von<br />
Alexandre Chemetoff und der Jardin Caille von Christine<br />
Dalnoky und Michel Desvignes – eigentlich Hybride aus Platz<br />
und Garten – in Lyon, der Platz der Einheit in Potsdam von<br />
WES und Partner, der Invalidenpark in Berlin von Christophe<br />
Girot und schließlich die neuen Quartierparks in Zürich-<br />
Oerlikon, insbesondere der Oerliker Park von Zulauf,<br />
Seippel und Schweingruber sowie der MFO-Park von<br />
Burckhardt und Partner mit Raderschall Landschaftsarchitekten<br />
sind einige europäische Beispiele aus den vergangenen<br />
zwei Jahrzehnten.<br />
Park und Platz zählen längst zu vereinheitlichenden Begriffen<br />
mit breiter thematischer Vielfalt. Infolge eines inflationären<br />
Gebrauchs haben sie ihre spezifische Aussagekraft<br />
verloren und werden deshalb gerne in neuen Kombinationen<br />
als Reizauslöser in unserer „Multioptionsgesellschaft“<br />
benutzt. Für solche hybriden Typologien, die die ersten<br />
Vokabeln einer neuen freiraumgestalterischen Sprache sein<br />
können, werden irgendwann neue Bezeichnungen zu prägen<br />
sein: wie zum Beispiel „urbane Hybridräume“ – eine<br />
Bezeichnung, die dem Umstand Rechnung trägt, dass sich<br />
neue Freiraumtypen in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten,<br />
Architekten und Stadtplanern entwickelt haben<br />
und deren Entstehung nicht nur auf einen tiefgreifenden<br />
Wandel im heutigen Natur- und Landschaftsverständnis<br />
zurückzuführen ist, sondern auch auf den Bedeutungswandel<br />
urbaner Öffentlichkeit.<br />
Der von der romantischen Natursehnsucht im späten 19. Jahrhundert ausgelöste<br />
und gegenwärtig durch die digitale Bildflut angeheizte Hunger der<br />
Industriegesellschaften nach idyllischen Bildern von unberührter, harmonisch<br />
gestalteter Natur und die Sucht nach immer neuen Freizeitoptionen ist<br />
mit traditionellen Stadtparkkonzepten nicht mehr zu stillen. Ebenso wenig<br />
ist von neuen suburbanen Stadtplätzen zu erwarten, dass sich darin noch<br />
das öffentliche Leben in gewohnter Weise widerspiegelt. Das überkommene<br />
Bild städtischer Öffentlichkeit ist längst durch neue Arten des Raumgebrauchs<br />
in Frage gestellt und muss neu definiert werden. „So wäre es<br />
auch möglich“, schreibt Klaus Selle, „unbelastet vom kulturpessimistischen<br />
Postulat des ‚Verfalls und Endes des öffentlichen Lebens’ (vgl. Sennett 1998)<br />
zeitgemäße Funktionen und Nutzungsformen öffentlicher Räume zu entdecken<br />
und nach Folgerungen für Planung, Bau oder Pflege und Entwicklung<br />
zu fragen [...]“ (Selle 2002). Der urbane Hybridraum, jener dialektische,<br />
transparente Ort zwischen Park und Platz, Alt und Neu, Natürlichkeit und<br />
Künstlichkeit entzieht sich der eindeutigen Lesbarkeit und ist womöglich<br />
gerade deshalb als zeitgemäßer Freiraumtyp weiter zu entwickeln.<br />
Literatur<br />
Freyermuth, G. S.: „Warum hast Du so große Ohren?“<br />
in Neue Zürcher Zeitung Folio. Juli 1998<br />
Geuze, A.: „Moving beyond Darwin“.<br />
in Knuijt, M., Ophuis, H., Van Saane, P. (Hg.): Modern Park Design. Recent Trends.<br />
Amsterdam 1993<br />
Kienast, D. zitiert aus: Weilacher, U.: Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art.<br />
Basel / Berlin / Boston 1996/1998<br />
Rauterberg, H.: „Drinnen ist draußen. Draußen ist drinnen. Hat der öffentliche Raum noch eine<br />
Zukunft?“ in Deutsches Architektenblatt. Februar 2001<br />
Selle, K.: „Stadt und öffentlicher Raum. Thema mit Variationen.“<br />
in Kornhardt, D., Pütz, G., Schröder, T. (Hg.):<br />
Mögliche Räume. Stadt schafft Landschaft. Hamburg 2002<br />
Spielberg, S.: Deconstructing Minority Report. Twentieth Century Fox 2002<br />
45




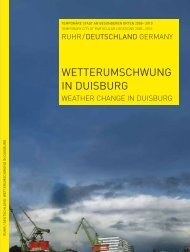
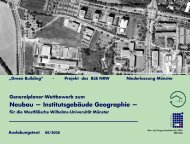





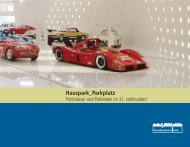




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)