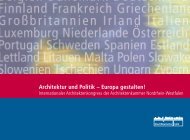5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unter dem Titel Privatgrün 2004 veranstaltete der Fuhrwerkswaage-Kunstraum<br />
in Köln eine Ausstellungstrilogie, in deren Fokus private Gärten als<br />
Orte der Präsentation für zeitgenössische Kunst standen. Die Konzeption<br />
der Ausstellung lehnte sich an das erstmals 1994 unter dem Titel Privatgrün<br />
erfolgreich durchgeführte Projekt an, das 21 Bildhauerinnen und Bildhauern<br />
ebenso viele Gärten wie Präsentationsorte öffnete. In Form von<br />
Skulpturen, Bauwerken und Bepflanzungen reflektierten die realisierten<br />
Arbeiten auf unterschiedliche Weise das Thema der Garten-Kunst und<br />
gaben auf Grund dieses individuellen, originären Ortsbezugs Anregungen,<br />
die eigene Beziehung zu Natur, Garten und Landschaft zu überdenken.<br />
Die positive Resonanz einerseits wie auch ein durch interventionistische<br />
Praxis und temporäre Artikulationen veränderter Blickwinkel auf Kunst und<br />
Garten durch eine neue Künstlergeneration andererseits bildeten zehn<br />
<strong>Jahre</strong> später die Basis für eine Fortsetzung und Erweiterung von Privatgrün.<br />
Im Gegensatz zu Ausstellungen der vergangenen <strong>Jahre</strong>, die zeitgenössische<br />
Kunst in Parkanlagen (hellgruen, Düsseldorf 2001; Aquaplaning, Bad<br />
Oeynhausen 2000) oder im Stadtraum (Hamburg 2000) realisierten, lenkte<br />
Privatgrün 2004 den Fokus auf den Privatbereich des Gartens im urbanen<br />
Kontext. Auf diese Weise soll der breite Diskurs über Kunst im öffentlichen<br />
Raum erweitert werden: auf Fragestellungen nach der künstlerischen Gestaltung<br />
von privaten Räumen und ihrer Relevanz für soziale Systeme als<br />
Orte des Rückzugs und der Utopie, als Spiegel von Gesellschaft, von Ordnung<br />
und Dissens.<br />
In drei separaten Ausstellungen setzten sich die eingeladenen 55 Künstlerinnen<br />
und Künstler mit der jeweiligen Situation des Gartens auseinander.<br />
In einem ersten Teil wurden insgesamt 18 Hausgärten in Kölns südlichem<br />
Stadtteil Sürth zu Orten zeitgenössischer Kunst. Hierbei reichte das Spektrum<br />
der Grünareale vom kleinen Innenhof mit etwa 20 Quadratmetern bis<br />
zum Auengarten mit mehr als 2000 Quadratmetern. Eine gänzlich unterschiedliche<br />
Situation des privaten Gartens markieren Kleingärten in einer<br />
Schrebergartenkolonie. Hier traten die Kunstwerke in einen Kontext,<br />
geprägt von Regularien der Nutzung des Grüns, von unmittelbarer Nachbarschaft<br />
und Vereins-Charakter. Im Übergang vom privaten zum öffentlichen<br />
Raum gelegen, unterscheiden sich die Klein- oder Schrebergärten von<br />
Hausgärten durch ihre Anlage und Konzentration. Dieser<br />
Teil des Ausstellungsprojektes fand in 18 Gärten der Kleingartenanlage<br />
Sonnenhang im Stadtteil Köln-Rodenkirchen<br />
statt. „Grüne Inseln“, Symbiosen von Vorortsituation und<br />
Urbanität bildeten im dritten Teil der Ausstellung dann<br />
18 Dachgärten in der südlichen Innenstadt Kölns (Chlodwigplatz,<br />
Ubierring, etc.). Hoch über dem Stadtverkehr wurden<br />
diese – konstruierten – Grünareale zu Zonen der Ruhe, vor<br />
allem aber auch des weiten Blicks. In allen drei Teilausstellungen<br />
war in jedem Garten ein geschulter Betreuer präsent,<br />
der zu dem jeweiligen Kunstwerk Auskunft geben und über<br />
Absicht und Hintergründe informieren konnte. Anders als<br />
bei Haus- und Schrebergärten – mit freiem Zugang für<br />
Publikum an den Wochenenden – wurden die Besucher der<br />
Dachgärten in Kleingruppen geführt. Mit mehr als 10.000<br />
Besuchern wurde die gesamte Ausstellungstrilogie sehr gut<br />
angenommen.<br />
Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Ausrichtung<br />
thematisierten bei Privatgrün 2004 den privaten grünen<br />
Außenbereich als individuelles Rückzugsgebiet. Sowohl junge,<br />
noch unbekannte, aber bereits positiv aufgefallene als auch<br />
renommierte Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen.<br />
Zehn <strong>Jahre</strong> nach Privatgrün war die Fortsetzung 2004<br />
nicht nur ein Spiegel eines weiterentwickelten Kunstverständnisses,<br />
sondern auch einer anderen Künstlergeneration.<br />
Darüber hinaus sollte Privatgrün 2004 die Aufmerksamkeit<br />
auf den privaten grünen Außenbereich als einen Ort für<br />
Kunst lenken, insbesondere hinsichtlich der originären Ortsbezogenheit<br />
der Skulpturen. Dabei befanden sich alle drei<br />
Ausstellungssituationen geographisch auf einer Nord-Süd-<br />
Achse: vom „Häuschen im Grünen“ im Vorort über den<br />
Schrebergarten am Stadtrand bis zum Dachgarten im<br />
Zentrum.<br />
59




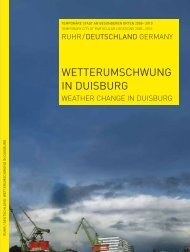
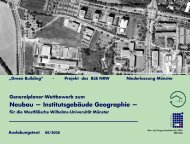





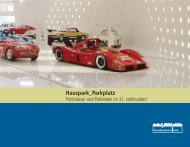




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)