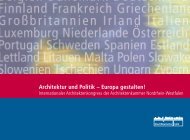5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dirk Haas<br />
Im europäischen Kontext gilt das Ruhrgebiet als einzigartiges Konglomerat<br />
aus verstädterten Territorien, großmaßstäblichen Infrastrukturen und posturbanen<br />
Wildnissen, als ein Typus städtischer oder besser: stadtregionaler<br />
Entwicklung, der mit der feudal-bürgerlichen Tradition der Europäischen<br />
Stadt nur wenig gemein hat. Der vermeintliche Wirrwarr an Nutzungen,<br />
Funktionen und Identitäten, die Vielzahl von Grenzen, Übergangsräumen,<br />
blinden Flecken und oszillierenden Zuständigkeiten, die versteckte Dichte –<br />
ganze Generationen von Ruhrgebietsplanern haben hier in guter Absicht<br />
Raumordnung zu betreiben versucht und sich dabei zumeist an traditionellen<br />
Stadt-Vorstellungen orientiert.<br />
Mittlerweile ist die alte Sehnsucht nach eindeutiger Ordnung, die das Ruhrgebiet<br />
immer als defizitären Raum begreifen musste, einem neuen „poetischen<br />
Realismus” gewichen. Dieser Realismus anerkennt, dass sich das<br />
Ruhrgebiet nach anderen Parametern vermisst: Pluralität statt Einheit, Heterogenität<br />
statt Einheitlichkeit, Hybridität statt klarer Identitäten, Komplexität<br />
statt Einfachheit, Brüche statt Kontinuität. Das sind, so bezeichnen es die<br />
Kulturwissenschaften, die Parameter der Zweiten Moderne. Insofern ist das<br />
Ruhrgebiet für viele grundsätzliche Zukunftsfragen ein viel versprechendes<br />
Experimentierfeld, eine Avantgarderegion wider Absicht. Im Jahr 2010 will<br />
sich diese Region folgerichtig als eine Europäische Kulturhauptstadt ganz<br />
neuen Typs präsentieren.<br />
Die Einsicht, sich angesichts der strukturellen Besonderheiten der Region<br />
von idealisierten Stadt-Vorstellungen befreien zu müssen, fällt zusammen<br />
mit einem generell wachsenden Interesse an der Regionalisierung des Städtischen<br />
und den daraus resultierenden Konsequenzen für die stadtplanerische<br />
und baukulturelle Praxis, und zwar nicht nur im Ruhrgebiet und seinen<br />
zyklisch wiederkehrenden Ruhrstadt-Debatten, sondern im gesamten europäischen<br />
Raum. Im Fokus steht eine andere Form der europäischen Stadt,<br />
die der „Europäischen Agglomeration”. Für die bislang eher an traditionellen<br />
Stadtbildern orientierte Idee der Europäischen Kulturhauptstadt wäre<br />
die Vergabe des Titels an das Ruhrgebiet also ein wichtiger und längst überfälliger<br />
Blickwechsel, wenn künftig von der Zukunft des Städtischen in Europa<br />
die Rede ist.<br />
Die Gestaltbarkeit regionaler Stadtlandschaften ist deshalb ein zentrales<br />
Thema im Bewerbungskonzept der Ruhrgebietsstädte zur Europäischen Kulturhauptstadt.<br />
Im Programmfeld „Stadt der Möglichkeiten” werden verschiedene<br />
Leitprojekte und Schauplätze entwickelt, die richtungweisende<br />
38<br />
Hauptstadtplanungen<br />
Werkstattgespräche zur Bewerbung des<br />
Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas 2010<br />
Ansätze zur Gestaltung einer regionalen Europäischen Kulturhauptstadt<br />
verfolgen und erproben sollen. Wie es gelingen<br />
kann, das weitläufige und unübersichtliche Ruhrgebiet<br />
zu einer atmosphärisch dichten Erlebnislandschaft zu entwickeln,<br />
dazu hat das Europäische Haus der Stadtkultur<br />
gemeinsam mit dem Bewerbungsbüro „Kulturhauptstadt<br />
Europas 2010: Essen für das Ruhrgebiet” ein öffentliches<br />
Forum und zwei Werkstattgespräche durchgeführt, die im<br />
Februar und November 2005 im stadt.bau.raum in Gelsenkirchen<br />
stattfanden.<br />
Die Veranstaltungen haben Akteure und Experten aus den<br />
Bereichen Kultur, Architektur, Planung, Design, Wirtschaft,<br />
Verkehr und Tourismus zu einem überraschend engagierten<br />
und ergebnisreichen baukulturellen Dialog zusammengeführt:<br />
Inwieweit bedarf das Ruhrgebiet neuer ausdrucksstarker<br />
architektonischer Symbole, neuer ikonographischer<br />
Signaturen, die sich zum einen von dem zum Selbstbild<br />
gewordenen Image eines „Nationalparks Industriekultur”<br />
lösen, zum anderen die ästhetische Mittelmäßigkeit der faktischen<br />
neuen Zentren des Ruhrgebiets (Neue Mitte Oberhausen,<br />
Arena AufSchalke etc.) überwinden? Oder braucht<br />
das zuweilen an-ästhetische Ruhrgebiet nicht viel eher eine<br />
neue Alltagskultur des Bauens, ein neues, zu Anfang vielleicht<br />
noch dissidentes Qualitätsempfinden, das sich nicht<br />
über „große Architektur”, sondern über ungewöhnliche,<br />
experimentelle Praktiken in den eher alltäglichen Bauaufgaben<br />
im Ruhrgebiet entwickeln könnte? In der Diskussion<br />
dieser Fragen sind nicht nur neue Einsichten ob der Notwendigkeit<br />
einer stärker investigativen baukulturellen Forschung<br />
und Praxis entstanden, sondern auch einige konkrete<br />
Projektideen für die Kulturhauptstadt selbst: zum Beispiel<br />
die Idee vom „wohnwagenwerk.ruhr” als einem integrierten<br />
und stadt-ästhetisch doch autonomen Mobilitäts- und Beherbungskonzept<br />
für die Besucher der Kulturhauptstadt<br />
oder das „fliegende Rathaus” als mobiles icon für den mit<br />
der Bewerbung verbundenen Gründungsakt einer neuen<br />
(Kulturhaupt-)Stadt.




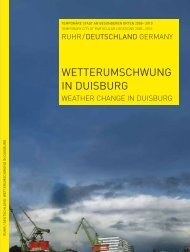
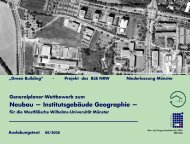





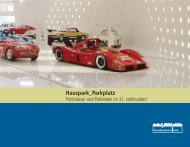




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)