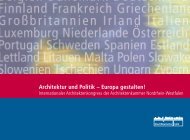5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hans-Dieter Collinet<br />
Eine zivile Gesellschaft zeichnet sich durch die kritische Reflexion im Umgang<br />
mit ihrem kulturellen Erbe aus. Diese Fähigkeit – auch in der kulturellen Auseinandersetzung<br />
mit aktuellen sozioökonomischen Prozessen wie dem vielgestaltigen<br />
Strukturwandel – formt ihr kulturelles Profil, ihre Identität, vor<br />
allem in Konfliktsituationen. Mit dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes <strong>NRW</strong> 1980 erlangte zwar die Bau- und Bodendenkmalpflege<br />
schon sehr früh ein hohes Ansehen und eine breite öffentliche Akzeptanz, die Gartendenkmalpflege<br />
aber musste um ihre Rolle erst noch kämpfen. Der Wert des Gartens als Kunstwerk und Objekt der<br />
Geschichte wurde immer wieder durch gesellschaftliche Interessen für opportune Nutzungen oder durch<br />
einseitige ökologische Maximen zurückgedrängt. Das gartenkulturelle Erbe in unserem Land schien fast<br />
in Vergessenheit zu geraten, denn die gestalterische Idee der Raumkunst mit der Natur kann man nur so<br />
lange erkennen, wie man sie pflegend und hegend erhält. Und genau das war in den „wachsenden<br />
Monumenten“, wie der Landeskonservator Prof. Mainzer sie bezeichnet hat, in den letzten beiden Jahrzehnten<br />
der Biotopisierung unserer Um- wie Gedankenwelt fast verpönt. Vernachlässigung, Verwahrlosung<br />
und schließlich Entwertung waren dann die logische Folge. Dabei hat doch beides, das Ökologische<br />
wie das Ästhetische, seine Rechtfertigung, ja seinen Sinn. Wir leben mehr in einer von Menschenhand<br />
geschaffenen Kulturlandschaft als in einer natürlichen Landschaft. Und für die Kulturlandschaft sind wir<br />
selbst verantwortlich: für ihren ökologischen Wert, aber auch für ihr Bild. Das unverwechselbare typische<br />
Stadt- und Landschaftsbild erst ermöglicht Wertung und Auseinandersetzung, schafft Identität oder<br />
Heimat. Vor allem dort, wo neue Räume etwa im Zuge des Strukturwandels entstehen, sind wir aufgefordert,<br />
den Gestaltungsauftrag anzunehmen.<br />
Dies war das Leitmotiv der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im<br />
nördlichen Ruhrgebiet. Sie führte in den 1990er <strong>Jahre</strong>n ingeniös Natur mit<br />
Kunst und Industriebaukultur synergetisch zusammen. Sie knüpfte aus einem<br />
tiefen ökologischen Anliegen an die Tradition des Gestaltungswillens<br />
europäischer Gartenkunst und Landschaftskultur mit einer eigenen, der Zeit<br />
und dem Raum gemäßen Übersetzung an. Kommuniziert wird der 320 qkm<br />
große Emscher Landschaftspark, das größte Landschaftsbauwerk unserer<br />
Zeit, über herausgehobene, gestaltete Orte. Kunst ist an diesen Orten nicht<br />
additives Beiwerk, sondern – als Landmarken überhöht – Wächterin dieser<br />
neuartigen Industriekulturlandschaft. Der Emscher Landschaftspark ist ein<br />
weltweit beachtetes Beispiel einer gelenkten Rückeroberung der Stadt durch<br />
die Natur in einer schrumpfenden Industrieregion – selbst dort, wo „Urwald“<br />
geplant ist. Er wird zum stadträumlichen Rückgrat des Strukturwandels im<br />
Ruhrgebiet. Mit den Routen der Industrienatur und Industriekultur wird diese<br />
künstlerische Transformation einer Industrielandschaft zum Alleinstellungsmerkmal,<br />
zur Basis eines umfassenden touristischen Konzeptes für das<br />
nördliche Ruhrgebiet; einer Region im Übrigen, in der Tourismus bis vor<br />
wenigen <strong>Jahre</strong>n noch ein Fremdwort war.<br />
130<br />
Gartenkunst in <strong>NRW</strong><br />
Zur Kultur des gestalteten Freiraums




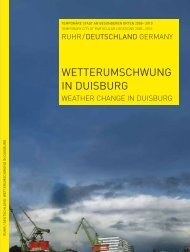
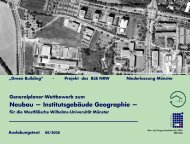





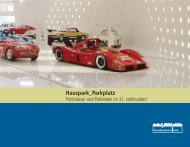




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)