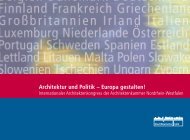5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nichts ist mehr so wie es ist in der Stadt. Die Stadt verändert<br />
sich und die Stadtgesellschaft weiß nicht mehr so recht, was<br />
anfangen mit ihrem öffentlichen Raum. Infolge des Verlustes<br />
traditioneller städtischer Funktionen befürchten die einen<br />
eine dauerhafte Entleerung des Stadtraums. Andere sorgen<br />
sich gerade um die immer etwas künstlich anmutende neue<br />
Fülle der Städte dank Festivalisierung und eventmäßiger<br />
Aufbereitung, da sie auf lange Sicht eher eine Banalisierung<br />
und Entwertung des öffentlichen Raums befördere. Es werden<br />
Klagelieder einer zunehmenden Ödnis und Verwahrlosung<br />
gesungen und zugleich Hymnen über eine neue Lust<br />
am Stadtraum angestimmt.<br />
Der Stadtplaner, der immer auch Stadtkritiker ist, neigt sich –<br />
je nach Ort und Stimmung – mal der einen, mal der anderen<br />
Seite zu und wäre angesichts der wechselnden urbanen<br />
Szenarien schlicht überfordert, sollte er die Zukunft des<br />
öffentlichen Raums prognostizieren. Es werden wohl – so<br />
viel steht fest – verschiedene Zukünfte sein, abhängig von<br />
Region, Stadtgröße, Nutzung und Kultur. Es gibt genügend<br />
Hinweise darauf, dass konträre Szenarien nebeneinander<br />
existieren und durchaus auch koexistieren werden.<br />
Um das Phänomen des Wandels des öffentlichen Raums<br />
besser in den Blick zu bekommen, ist es hilfreich, den Blickwinkel<br />
zu erweitern: Denn in dem Maße, in dem mit der<br />
gestiegenen Mobilität von Menschen, Gütern und Informationen<br />
die existentielle Angewiesenheit auf die räumliche<br />
Nähe der Stadt entfiel, hat die Stadt auch ihre historischen<br />
räumlichen Schranken überwunden. Von einer Ortsgebundenheit<br />
urbaner Lebenssituationen im klassischen Sinne<br />
kann heute in der europäischen Stadt nicht mehr gesprochen<br />
werden. Und so wie sich die räumlichen Bindungen<br />
gelockert haben, hat sich auch die Stadtgesellschaft ausdifferenziert<br />
in eine große Zahl von gesellschaftlichen Gruppen<br />
mit differenzierten Lebensstilen und Ansprüchen an den<br />
Stadtraum. Je nach Gruppenzugehörigkeit und Lebensstil<br />
werden heute andere urbane Orte gewählt – Orte, die sich<br />
nicht mehr auf einen Quadranten im Zentrum der Stadt<br />
konzentrieren, sondern sich über die Stadtregionen verteilen.<br />
So haben sich in der heutigen Stadtlandschaft, die zu regionalen<br />
Netzen zusammengewachsen ist, parallele Welten der<br />
Urbanität herausgebildet, die – in ihrer scheinbaren Widersprüchlichkeit<br />
– so eng in den heutigen gesellschaftlichen<br />
Prozessen verankert sind wie die mittelalterliche Stadtgesellschaft<br />
im öffentlichen Raum zwischen Handelsplatz, Rathaus<br />
und Kirche oder das Bürgertum im nachrevolutionären<br />
Frankreich auf der Bühne der städtischen Boulevards.<br />
Es sind Orte, die von der sich häutenden postindustriellen<br />
Stadt zurückgelassen werden, teilweise in Privatbesitz, aber<br />
ohne erkennbare Eigentumsgrenzen; ihre Aneignung ist<br />
informell, offen und ungeregelt. Sie sind vielschichtig zu<br />
lesen und in den heutigen Stadtregionen „mindestens so<br />
wichtig wie die Bemühungen um eine Renaissance der<br />
Bürgerplätze“ (Boris Sieverts). Urbane Ereignisse entstehen<br />
zunehmend außerhalb der Stadträume, die ihnen bisher gewidmet waren,<br />
in Übergangszonen, transitorischen Räumen.<br />
Man könnte diese Form des Stadtlebens auch als urbane Episoden bezeichnen.<br />
Wer an ihnen teilhaben möchte, ihre Orte und Netzwerke nutzen will,<br />
muss ihre Landkarte verstehen, muss ihre codes lesen können. Das Entstehen<br />
einer fast schon subversiven Form der Urbanität entspricht den Lebensgewohnheiten<br />
der Stadtbewohner und der Morphologie heutiger Stadtregionen<br />
möglicherweise mehr als die zusammenhängenden Raumgefüge<br />
der alten Stadt.<br />
Welche Rolle kann ein Landeswettbewerb in dieser unübersichtlichen Situation<br />
spielen? Mit dem mehrstufigen Wettbewerb „Stadt macht Platz – <strong>NRW</strong><br />
macht Plätze“ wurde der Anspruch formuliert, zeitgemäße Antworten auf die<br />
veränderte Bedeutung des öffentlichen Raums zu finden und dabei höchste<br />
Gestaltqualität mit nachhaltigen Nutzungskonzepten zu verbinden. An einigen<br />
charakteristischen Projekten lässt sich der Stand der Dinge dokumentieren:<br />
- Stadtbild.Intervention Pulheim: Über temporäre künstlerische Installationen<br />
werden Nicht-Orte wie ein Parkdeck thematisiert und stadträumliche<br />
Zusammenhänge kenntlich gemacht. Ohne erhobenen Zeigefinger lenkt<br />
die Kunst den Blick auf das urbane Potenzial alltäglicher Orte.<br />
- Rheinbraunplatz Wesseling: Ein ehemaliges Betriebsgelände bietet der<br />
Innenstadt einen neuen Zugang zum Rhein. Zum Wasser orientierte Sitztreppen<br />
bilden den Außenraum für ein neues Bürgerhaus im umgebauten<br />
Werksgebäude. Identität stiftende Elemente der industriellen Nutzung<br />
wie eine Kranbahn sind in die Platzgestaltung integriert.<br />
- Innenstadtplätze Ahaus: Die gestalterische Neuordnung und funktionale<br />
Stärkung der Innenstadt erfolgt durch Platzräume, die unterschiedlichen<br />
Nutzungen entsprechend gestaltet werden. Auf diese Weise wird der<br />
kleinteilige Charakter der Innenstadt gestärkt.<br />
- Bethelplatz Bielefeld: Ein Wettbewerbsverfahren und ein vorgeschalteter<br />
intensiver Beteiligungsprozess sind Kennzeichen der Bemühungen, höchstmögliche<br />
Funktionalität und vor allem Akzeptanz der späteren Nutzer zu<br />
gewinnen.<br />
Die Partizipation gewinnt in der dritten Phase des Wettbewerbs noch stärker<br />
an Bedeutung. Als Beispiel sei die Vorgehensweise der Stadt Münster bei<br />
der Gestaltung des Platzes vor dem Picassomuseum angeführt: Der Platzraum<br />
ergab sich aus einem vor mehreren <strong>Jahre</strong>n durchgeführten städtebaulichen<br />
Wettbewerb. Um zu einer gestalterischen Lösung zu kommen, wurden die<br />
vier Preisträger zu einem mehrtägigen Workshop eingeladen. Als Input dienten<br />
die Ergebnisse eines moderierten Beteiligungsprozesses, in dem eine gut<br />
hundertköpfige Bürgergruppe ihren Vorstellungen über die Zukunft dieses<br />
Stadtraums in Wort, Bild und Modell Ausdruck verliehen hatte. Das Beteiligungsergebnis<br />
ging auch in die Beurteilungskriterien der Jury ein.<br />
Die Lage der Dinge in Sachen öffentlicher Raum hat sich also verändert.<br />
Aus einem sehr scharf gezeichneten Bild des Stadtplatzes mit eindeutig<br />
zugeordneten Bedeutungen und Aufgaben ist eine breite Leinwand geworden,<br />
auf der vielfältige Raumkonstellationen und Nutzungen abgebildet<br />
werden können. Das Panoramabild solcher Plätze und Platzangebote versteht<br />
sich als Möglichkeitsraum. Ob und wie sich Farbe auf ihnen verteilt,<br />
hängt mehr denn je von den Menschen ab, die den Raum nutzen. Je mehr<br />
sie sich dem Stadtraum verpflichtet fühlen, desto klarer wird das Bild.<br />
55




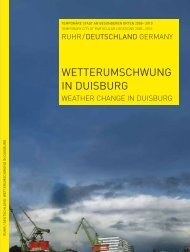
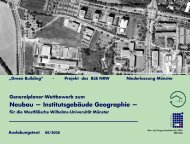





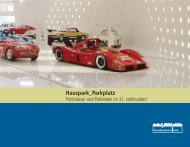




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)