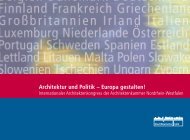5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Verständigungsprobleme?<br />
Kommunikationsaufgaben?<br />
Um die Fülle der Herausforderungen zu verdeutlichen, kann<br />
man weit ausholen – und früh beginnen, zum Beispiel bei<br />
der Urhütte. Deren Entstehung und Entwicklung wird man<br />
sich als kontinuierliches Palaver vorstellen dürfen: Die Erprobung<br />
geeigneter Techniken bedurfte des Erfahrungsaustausches,<br />
die Beschaffung der Baustoffe musste gemeinsam<br />
organisiert werden und das Zusammenfügen vor Ort wird<br />
wohl auch lautreich erfolgt sein. Dieser Urzusammenhang<br />
der am Planen und Bauen Beteiligten zerfiel im Laufe der<br />
Geschichte in immer stärker ausdifferenzierte Rollen: Bauherren<br />
und Nutzer trennten sich, Handwerker unterschieden<br />
sich in zunehmend spezialisierte Gewerke, die Baumeister<br />
traten auf den Plan – zunächst noch als Generalisten, dann<br />
in immer weitere Einzeldienstleistungen sich aufgliedernd,<br />
das Öffentliche wurde vom Privaten geschieden und – überspringen<br />
wir die Zeiten – heute reichen die viele Quadratmeter<br />
großen Bauschilder kaum aus, um alle Beteiligten<br />
eines Vorhabens aufzulisten.<br />
Dieser Prozess hat nicht zuletzt das Entstehen von wechselseitigen<br />
Vorurteilen befördert: Architekten halten Ingenieure<br />
für gestalterisch unbegabte Techniker und jene diese<br />
für formverliebte Tagträumer. Nutzer sehen in Architekten<br />
gerne Zeitgenossen, die sich auf Kosten anderer Denkmäler<br />
setzen und Stadtplaner sind ihnen diejenigen, die die Städte<br />
hässlich machen. Fachleute hingegen sprechen von den<br />
Nutzern oder der breiten Öffentlichkeit gerne als Laien, die<br />
von der Sache nichts verstehen und denen ein halbwegs<br />
akzeptables Geschmacksempfinden ohnehin abgesprochen<br />
werden muss. Erleichtert wird die Pflege solcher Vorurteile<br />
dadurch, dass man den Kontakt untereinander meidet und<br />
sich an der eigenen Bezugsgruppe orientiert. Beredt ist<br />
man zwar allenthalben, aber weitgehend sprachlos, was die<br />
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen<br />
betrifft.<br />
Solche Vorurteile beinhalten immer auch Unkenntnis. Häufig<br />
wissen zum Beispiel die Produzenten und Entscheider<br />
nicht, was die Nutzer und Endverbraucher eigentlich wollen,<br />
wie sie Gebäude und Stadt wahrnehmen, nutzen, was sie<br />
aus welchen Gründen schön oder hässlich finden, welche<br />
Bedürfnisse und Interessen sie haben. Eine Zeit lang spran-<br />
68<br />
gen hier die Sozialwissenschaften helfend ein, aber die fragt heute kaum<br />
noch jemand. Ihre Lücke füllt in zunehmendem Maße die Marktforschung,<br />
gerade weil der Immobilienmarkt so unstet geworden ist. Der eigentlich<br />
naheliegende Versuch direkter Verständigung – zwischen Produzenten und<br />
Nutzer – wird selten unternommen. Insofern steckt in der unschuldig daher<br />
kommenden Überlegung, es müsse bei der Förderung der Baukultur letztlich<br />
darum gehen, dass die Menschen „sich in ihren Häusern, ihren Städten<br />
wohler fühlen…“ (Rauterberg in: Förderverein 2001, S. 41) gleich in mehrfacher<br />
Hinsicht Sprengkraft: Fühlen sie sich wirklich so unwohl? Wer fragt<br />
sie denn? Und: Würde jemand die Antworten ernst nehmen, die dann zu<br />
hören wären?<br />
Dieses seit alters her bekannte Kommunikationsproblem wird ergänzt und<br />
erweitert durch neuere Aufgaben, die gleichfalls mit den Baukultur-Initiativen<br />
thematisiert werden. So ist die Rede davon, dass auf die Leistungen der<br />
baulichen Berufsstände aufmerksam gemacht werden soll. Diese Marketingbemühungen<br />
richten sich an die hiesige Öffentlichkeit, sollen aber auch<br />
Investoren und Bauherren in aller Welt ansprechen, auf dass deutsche Baudienstleistungen<br />
noch deutlicher als wichtiges Exportgut sichtbar werden<br />
(vgl. auch BMVBW S. 52). Auch der Strukturwandel vieler Städte gibt Anlass<br />
zu mehr Kommunikation: Die Folgen wirtschaftlicher Umbrüche und demographischer<br />
Verwerfungen lassen sich nur in gemeinsamen Anstrengungen<br />
bewältigen. Damit wird zugleich auf tief greifende Rollenveränderungen in<br />
der Aufgabenverteilung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft verwiesen:<br />
Der Staat kann nicht (mehr) alles richten. Kooperationen sind unverzichtbar –<br />
auf allen Ebenen und zwischen verschiedenen Beteiligten (vgl. Selle 2005),<br />
Kooperationen, die ohne intensive Verständigungsarbeit nicht zu haben<br />
sind.<br />
Der Bedarf an Kommunikation ist also groß und besteht aus den verschiedensten<br />
„Kommunikationen”:<br />
- Marketing: Die Öffentlichkeit soll von den Leistungen der Architekten und<br />
Ingenieure in Kenntnis gesetzt werden;<br />
- Qualitätsdiskurs: Alle am Planen und Bauen Beteiligten sollen in Diskurse<br />
über mehr Qualität eingebunden werden;<br />
- kommunikative Projektentwicklung: Einzelne Vorhaben sollen in offenen<br />
und transparenten Verfahren unter Einbeziehung aller relevanter Akteure<br />
projektiert und realisiert werden;<br />
- Kooperation: Für viele Aufgaben sind Partner zu gewinnen und in<br />
gemeinsam getragene Prozesse einzubinden.<br />
Aber reicht das, um die bislang zu beobachtende Sprachlosigkeit zwischen<br />
den verschiedenen Gruppen zu überwinden? Wohl kaum, wenn über die<br />
Verkündung guter Absichten hinaus nicht auch Konkretes geschieht.




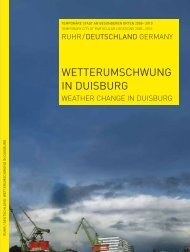
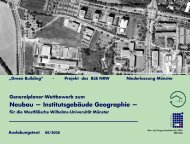





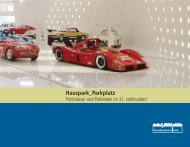




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)