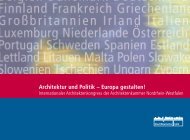5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Deutschlandschaftpanorama fand in gewisser Hinsicht<br />
bei seiner Heimkehr nach Deutschland in Nordrhein-Westfalen<br />
genau den richtigen Kontext. Als hybrider Rundblick<br />
auf eine sehr heterogene Auswahl architektonischer Projekte<br />
der letzten vier <strong>Jahre</strong> in Deutschland verschiebt diese<br />
Neuinterpretation des Panoramas bewusst den Brennpunkt<br />
auf Stadtrandlandschaften der Gegenwart: die konturlosen<br />
und ästhetisch ambivalenten Gegenden jenseits der Stadtgrenzen,<br />
die von Wohnsiedlungen durchzogenen Ballungsräume<br />
aus Lagerhallen, Einkaufszentren und Gewerbehöfen.<br />
Nach letzten Schätzungen befinden sich neben den zahlreichen<br />
ehemaligen Industrieflächen in Nordrhein-Westfalen<br />
60.000 Hektar Brachflächen, 10.000 Hektar Militärflächen<br />
und 900.000 m 2 in Shopping Malls. Ein passender Ort also<br />
für den peripheren Blick.<br />
Die anhaltende Ausuferung der Städte sowie deren zu oft<br />
unbeachteten inneren Peripherien manifestieren sich in der<br />
Ausstellung als zeitgenössischer Blick – eine Wiederkehr des<br />
dirty realism.<br />
Durch die Kombination aus diesem eher profanen Blick und<br />
der Verwendung eines klassischen, aus der Romantik gewohnten<br />
Mediums wurde ein Wechselspiel zwischen Realität<br />
und Fiktion, zwischen dem „Heimeligen” und dem Unheimlichen<br />
in der Deutschlandschaft möglich. Eine Anspielung<br />
auf das Gewohnte und Gewöhnliche und eine Zusammenführung<br />
transformativer Architekturprojekte erzeugten bei<br />
den Betrachtern des Panoramas genau die Ambivalenz und<br />
das Unbehagen, mit denen man die städtische Peripherie<br />
wahrnimmt. Mimo’s Dönerladen, Schrebergärten und sichtbar<br />
schlecht gebaute Eigenheime wurden teils mit einem<br />
Schmunzeln, teils als Irritation neben den neuen Architekturen<br />
mit entdeckt.<br />
Die zahlreichen Interviews mit den beteiligten Architekten<br />
ergaben für mich eine beeindruckende Haltung zu diesem<br />
wuchernden Terrain – nicht ohne eine gewisse Ironie hatte<br />
ich den Untertitel „Epizentren der Peripherie” verfasst, denn<br />
es ist einer Generation von Architekten und Planern in<br />
Deutschland sehr bewusst, dass man lediglich einen sehr<br />
begrenzten Einfluss auf diese Ballungsräume ausüben kann.<br />
Fertighaus-Produzenten, die Aldi/WalMart-Giganten der Konsumgesellschaft<br />
und Gewerbesteuern bestimmen viel eher<br />
die surrealen Nebeneinanderstellungen dieser Randgebiete.<br />
Um Transformationen im vor- und randstädtischen Umfeld vorzunehmen,<br />
muss man andere Sehgewohnheiten entwickeln. Julia Bolles Wilson brachte<br />
das Potenzial einer Wahrnehmungsverschiebung auf den Punkt: „Die Peripherie<br />
stellt ein zeitgenössisches Gefühl dar, in dem wir uns wohl fühlen;<br />
seine inhärenten Qualitäten bedeuten eine Art Freiheit. Es ist ein unhierarchisches<br />
Feld, in dem wir uns bewegen können, und bietet eine Anonymität,<br />
die Städte nicht mehr bieten können.”<br />
Eine Mischung aus Pragmatismus und Ironie, eine Bescheidenheit im Maßstab<br />
der in der Deutschlandschaft eingebetteten Projekte haben wir als<br />
„Architektur in homöopathischer Dosis” bezeichnet. Kulturelle Parameter<br />
und Bauvorschriften werden neu ausgelegt, Paradigmen verschoben.<br />
Architektur auf den zweiten Blick<br />
Als Fotocollage spielt das Panorama mit allen Möglichkeiten einer fotografischen<br />
Darstellung von gebauter Architektur. Wichtig war dennoch, die ausgewählten<br />
Projekte soweit wie möglich mit ihrer realen Umgebung in die<br />
Deutschlandschaft einzubetten, um die sehr präzisen Anspielungen auf den<br />
bestehenden Kontext und die gewohnten Bauformen deutlich zu machen.<br />
Statt die neuen Architekturansätze als ikonenhafte Solitäre auszustellen,<br />
wird für die Ausstellung die Fotografie als eine Art reality check und die<br />
Collage selbst als Aussage über das eher bezugslose Nebeneinander am<br />
Rande des Urbanen.<br />
Die teils subtilen, teils polemischen Umnutzungen und Umkehrungen gewohnter<br />
Baunormen und Materialien stechen aus dem Deutschlandschaftsbild<br />
hervor – verleugnen und verschönern jedoch nicht die Realitäten ihres<br />
Umfelds.<br />
Bei der Vielfalt der Themen und Ansätze, die in der Ausstellung unterzubringen<br />
waren, stellte sich in der Konzeptionsphase heraus, dass man mit einer<br />
scheinbar nahtlosen Fotocollage eine fast heile Welt präsentieren würde,<br />
eine täuschende Homogenität. Der Bruch in der Wahrnehmung – das<br />
eigentliche Ziel der Ausstellung – und das Fokussieren auf eine andere Art<br />
von Stadt erforderten einen Bruch im Panorama selbst. Somit bauten wir<br />
hinter dem Panorama eine zweite, disruptive Schicht, die als „Quellcode”<br />
in die Gestaltung eingreift: Auszüge aus dem Baugesetz sowie Hinweise<br />
auf die Pendlerpauschale und Eigenheimzulage weisen in beleuchteten Einblicken<br />
auf die oft restriktiven Bedingungen hin, mit denen jeder Architekt<br />
und Städteplaner in Deutschland konfrontiert wird.<br />
Letztendlich soll die Ausstellung zu weiteren Dialogen führen und die Wanderschaft<br />
entlang dieses etwas anderen Deutschlandbildes spielerisch-ambivalent<br />
bleiben. Die fragmentarischen Zitate aus Gesprächen und Interviews<br />
an der Sitzlandschaft deuten auf eine Auseinandersetzung mit der Peripherie,<br />
die noch lange nicht vollendet ist.<br />
25




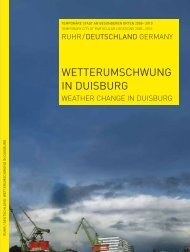
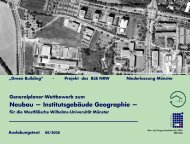





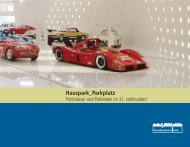




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)