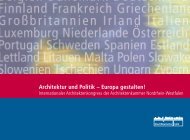5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
oder den Berliner Steinbaumeistern reicht die Palette derer,<br />
die eine Rückkehr zur Konvention des Bauens fordern.<br />
Jawohl, es wäre dann „Baukultur“, wenn sie sich durchsetzen<br />
könnte. Wir hätten dann wieder verbindliche Konventionen,<br />
wir hätten dann wieder, in neuen Spuren nur und<br />
das ist wichtig, harmonische Dörfer und Städte. Wir hätten<br />
den Verlust der Kultur kompensiert. Aber welche Kultur hätten<br />
wir dann? Die Kultur des Films „The Truman Show“,<br />
einer künstlichen Idylle, die zwar zufällig, aber doch treffend<br />
im realen New Urbanism-Pilotprojekt Seaside in Florida<br />
gedreht wurde. Das ist nicht gerade die great seriosity, die<br />
gefordert wird. Eine gegenwärtige Wiederkehr im Historischen<br />
ist sicherlich kein heutiges Leben im falschen Bewusstsein,<br />
wie viele Ewigmodernen gerne behaupten würden.<br />
Schließlich ist mit dem kompletten Wiederaufbau der Akropolis<br />
oder dem Weiterbau an der Sagrada Familia längst<br />
auch symbolisch das Leben im historisch Inszenierten beschlossen<br />
– und bleibt doch nur eine touristische Marginalie.<br />
Die great attention hat jedenfalls der Architektur eine bislang<br />
nicht bekannte öffentliche und mediale Aufmerksamkeit<br />
gebracht. Mit allen Konsequenzen. Eine davon ist das<br />
Ende der Expertenkultur. Kritik und Vermittlung finden sich<br />
entweder in der Rolle des Marketing-Agenten wieder oder<br />
weichen aus in die Paralleltexte der cultural studies, um von<br />
dort aus das Phänomen der Architektur an sich zu umkreisen.<br />
Individuelle kritische „Wertungen“ von Bauten und<br />
Positionen entpuppen sich als das, was sie seit langem auch<br />
in anderen Kulturdisziplinen sind: als neiderfüllte private<br />
Befindlichkeiten mit dem Odeur des pastorenhaft Unbefriedigten<br />
behaftet.<br />
Das ist die logische Folge des Verlusts aller verbindlichen<br />
Kriterien. Die kämpferische Moderne der Architektur hat<br />
sich im letzten Jahrhundert geboren und vollendet. Keinem<br />
stilistischen Code, keiner künstlerischen Ideologie folgend,<br />
aus reiner Gewohnheit baut sie einfach in der weltweiten<br />
Mittelschicht der Bauindustrie-Dienstleister weitgehend<br />
bewusstlos nach wie vor vor sich hin. Noch immer ausgestattet<br />
mit der Autorität des Berufsstandes des Architekten,<br />
die für sich das Versprechen auf eine bessere Welt behauptet.<br />
Würden wir den Architekten glauben, dann wäre alles besser,<br />
wäre es nur von Architekten geplant.<br />
Provokante Gegenfrage: Würden wir alle in einer Welt leben<br />
wollen, die nur von sogenannten engagierten Qualitätsarchitekten<br />
geschaffen wurde?<br />
74<br />
Wo ist der Nullpunkt?<br />
Diese kursorische Einschätzung der gegenwärtigen architektonischen Situation<br />
ist die Vorbedingung einer Suche nach dem Nullpunkt, von dem aus<br />
die Vermittlung von Architektur immer wieder beginnen muss. Und ich<br />
möchte das an den Aufgaben und Potenzialen einer Institution der Architekturvermittlung<br />
darstellen, die einfach zwischen der Entwicklung der Disziplin<br />
und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit steht. Als ich am Beginn<br />
bemerkte, dass man sich auch eine Welt ohne Architektur vorstellen möge,<br />
so bezog sich das auch auf die tatsächliche Situation der Vermittlung. Wir<br />
haben die paradoxe Situation, dass zwar alle Menschen von Architektur<br />
betroffen sind, alle auch irgendwie beim Bauen – das sie als Architektur<br />
bezeichnen – mitreden zu können glauben, aber absolutes Unverständnis<br />
und vollständige Unkenntnis über Architektur vorherrschend sind. Geschichte<br />
und Terminologie der Architektur sind nach wie vor ein relativ absolutes<br />
Minderheitenprogramm.<br />
Wir hatten mit dem Architekturzentrum Wien die großartige und einmalige<br />
Situation und Voraussetzung, geradezu experimentell fast alle Möglichkeiten<br />
heutiger Architekturvermittlung zu erproben. Architektur als kulturelle<br />
Verpflichtung, wir sagten als Lebensmittel, zu propagieren. Ausstellungen<br />
selbstverständlich, aber auch Workshops, Exkursionen, Kinderprogramme,<br />
Partnerschaften mit der Wirtschaft, Diskussionen, Präsentationen, Publikationen<br />
und die extensive Nutzung dessen, was seit Mitte der neunziger <strong>Jahre</strong><br />
über das Internet vermittelbar ist. Wien war und ist dafür ein heißes Pflaster.<br />
Sich und damit der Architektur Gehör zu verschaffen, ist im Umfeld eines<br />
reichen kulturellen Angebots besonders schwer.<br />
Was lernten wir daraus? Jawohl, wir haben für die Architektur politische<br />
und mediale Aufmerksamkeit erreicht. Nicht als institutionelle Kontrollinstanz,<br />
dazu fehlt die Macht. Aber immerhin konnten wir das Thema Architektur als<br />
kulturelle Aufgabe politisch und medial positionieren. Überraschend dabei<br />
war, dass für den Erfolg einer breiten Vermittlung das Starsystem der Architektur<br />
noch keine wirkliche Rolle spielt. Eine Star-Ausstellung bringt zwar<br />
mediale Aufmerksamkeit, aber letztlich auch nicht mehr Besucher als ein<br />
Alltagsthema mit lokaler Betroffenheit. Wogegen aber an inhaltlich phan-




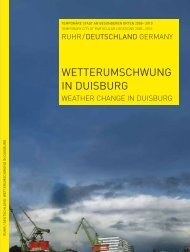
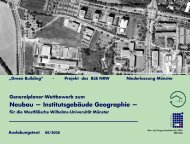





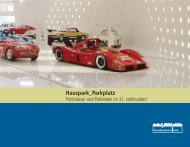




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)