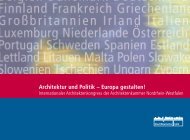5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
5 Jahre - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einem sehr bewussten, semantischen Umgang mit diesen<br />
geführt. Analog zur Sprachensituation diskutierte man<br />
Architektursprachen mit inhaltlichen Fixierungen und Zusammenhängen.<br />
So gesehen war eigentlich das 19. Jahrhundert,<br />
der Historismus, schon die Revolution der Moderne.<br />
Die Heimatschutzbewegungen, die sich gegen die erste<br />
Phase der Industrialisierung, der bautechnischen und typologischen<br />
Entwicklung und angeblichen architektonischen<br />
Gleichmacherei im 19. Jahrhundert wandten, haben nicht<br />
nur nationale Traditionen entdeckt – und wenn sie nicht<br />
vorhanden waren, konstruiert –, sondern auch regionale.<br />
Analog zu den zahlreichen Uniformen, die die Strukturen<br />
der Gesellschaft sichtbar machten (nicht nur im Militär),<br />
kamen die Trachten der Talschaften, der Stände und „Landmannschaften“.<br />
Analog wurde auch die regionalistische<br />
Architektur eingekleidet, so dass von Gottfried Semper bis<br />
Adolf Loos ein „Prinzip der Bekleidung“ diskutiert werden<br />
konnte.<br />
Die eigentliche Frage liegt also eher auf einer Wahrnehmungs-<br />
und Interpretationsebene: Was passt in eine Region<br />
und was passt nicht? Und solche Interpretationen sind natürlich<br />
abhängig von Denkweisen, Ideologien, politischen<br />
Absichten oder einfachen ökonomischen Interessen. Wenn<br />
eine Region für den Tourismus aufbereitet wird, werden selten<br />
echte, also meist falsche Interpretationen einer Region<br />
ins Spiel gebracht. Es werden leicht kopier- und multiplizierbare<br />
Klischees, plakative Elemente erzeugt, die mit der Vielfalt<br />
traditioneller Bauformen und -strukturen nichts mehr zu<br />
tun haben. So wurde der Regionalismus in Europa zu einem<br />
internationalen Phänomen, das – paradoxerweise – über<br />
die Regionen hinweg gerade das Gegenteil von dem produzierte,<br />
was es erreichen wollte: statt Vielfalt und kulturellen<br />
Landschaftsbezug eine öde Gleichmacherei.<br />
Deshalb geht es heute nicht mehr um die formale Interpretation von Regionen,<br />
um stilistische Einkleidung, um die Interpretation von kulturellen Situationen,<br />
sondern um ihre Erneuerung aus den heutigen Bedingungen. Die<br />
Moderne des 20. Jahrhunderts, obwohl aus einer Ablehnung des Stildenkens<br />
des 19. Jahrhunderts geboren, ist immer wieder, angefangen vom Heimatstil,<br />
Expressionismus, Funktionalismus, Internationalen Stil bis zur Post- und<br />
Spätmoderne, in die stilistische Falle getappt. Erfindungen, neue Gedanken<br />
und Entwicklungen wurden fast gleichzeitig formal repetiert, das heißt, der<br />
Historismus ist ein „systemimmanentes Phänomen“ der Moderne. Vielleicht<br />
wissen wir auch zu viel über das Medium Architektur, so dass uns immer<br />
wieder die Erinnerung einen Streich spielt, dass uns Sehgewohnheiten und<br />
das damit verbundene Zitieren den klaren Blick auf die Probleme verdecken.<br />
Außerdem sind unsere Erinnerungen in Bildern gespeichert, in Bildserien,<br />
und diese sind von ihren formalen Strukturen (also den „Stilen“) nicht zu<br />
trennen.<br />
Obwohl in Österreich, abgesehen von Tourismuszonen in den Alpen, der<br />
Begriff der Region kein aktuelles (modernes) Thema war, ist in der architektonischen<br />
Entwicklung nach 1945 eine merkwürdig vitale Regionalisierung<br />
festzustellen. Ein Impuls lag sicher in den vier Besatzungszonen von 1945-55,<br />
in denen die Besatzer – Amerikaner, Engländer, Franzosen und „Russen“<br />
(die Sowjetunion) – eine sehr unterschiedliche Kulturpolitik betrieben. Langzeitwirkung<br />
hat aber die politische Struktur Österreichs, wobei die Kulturpolitik<br />
Ländersache ist, sich also sehr unterschiedlich in den neun Bundesländern<br />
entwickelt. In vier Bundesländern gibt es Architekturhochschulen<br />
(Wien, Graz, Linz und Innsbruck), und inzwischen gibt es in allen Bundesländern<br />
sehr unterschiedlich strukturierte und benannte „Architekturhäuser“,<br />
die wesentlichen Anteil an der Erforschung, Aufarbeitung und permanenten<br />
Verbreitung von Architektur auf allen möglichen Ebenen haben. Allen Ländern<br />
gemeinsam ist, dass der Regionsbegriff ein offener, zeitzugewandter,<br />
nicht selbstdarstellerischer oder gar rückwärtsgewandter, formal inszenierter<br />
ist. Die regionalen Unterschiede entwickeln sich nicht entlang touristischer<br />
Selbstdarstellungsprogramme – so sehr dies der Tourismus beständig<br />
versucht –, sondern aufgrund der ökonomischen und kulturellen Ressourcen,<br />
unter den Bedingungen der Länder und vor allem aufgrund der personellen<br />
Aktivitäten in der Architektenschaft. Dazu gehört auch eine langsam anwachsende<br />
öffentliche Architekturrezeption (ständige Berichte in den<br />
Tageszeitungen, Ausstellungen, Besichtigung von Baustellen und sehenswerten<br />
Bauten, Atelierbesuche etc.), die in den verschiedenen Bundesländern,<br />
unseren „Regionen”, sehr unterschiedlich ausgebildet ist.<br />
115




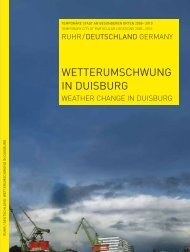
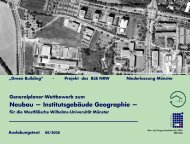





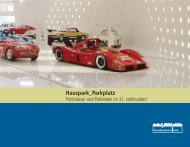




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)