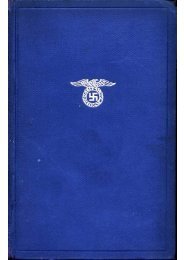menuhin-gerard-deutch-wahrheit-sagen-teufel-jagen-komplett
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ich glaube, es begann mit einer dumpfen Vorahnung, mehr war es nicht. Nicht einmal ein vages<br />
Gefühl, geschweige denn die Gewissheit, dass alles, was man dem Durchschnittskind über große<br />
historische Ereignisse eintrichtert, Lug und Trug ist. Es war nicht mehr als ein leiser, nagender<br />
Zweifel. Mein Vater sprach nie vom Krieg, wie er überhaupt nie von negativen oder unangenehmen<br />
Dingen sprach und es möglich tunlichst vermied, die Vergangenheit zur Sprache zu bringen. Meine<br />
Mutter hingegen sprach die meiste Zeit über von der Vergangenheit. Von ihrer Vergangenheit. Doch je<br />
nach Stimmung sprach sie auch von der Überlegenheit der edwardianischen Architektur über die<br />
viktorianische, oder von ihrem unfehlbaren Gefühl für Kleidung und Zierart, oder über ihre<br />
Kriegserlebnisse. Sie vertrat die Überzeugungen ihrer Generation, darunter jene, dass Churchill ein<br />
großer Mann und Neville Chamberlain ein einfältiger Gimpel gewesen sei (das Wort „appeasement“,<br />
„Beschwichtigungspolitik“, muss seinen anrüchigen Klang unbedingt beibehalten, obwohl jeder<br />
Versuch, einen Krieg zu verhindern, doch lobenswert ist). Zwar sagte sie meinem Bruder und mir<br />
bisweilen mit Gruselstimme: „Wenn ihr in Deutschland gelebt hättet, wäret ihr vergast worden“ („ihr“,<br />
nicht „wir“!), doch war sie keinesfalls deutschfeindlich eingestellt und konnte sogar ein wenig<br />
Deutsch. Natürlich bildete Deutschland keinen Teil ihrer Vergangenheit und wurde deshalb auch nicht<br />
erwähnt, wenn sie, was sie ständig tat, über ihre Erinnerungen sprach. Ich bin nie einem Menschen<br />
begegnet, dessen Ansichten so vorbehaltlos auf althergebrachten Kriterien beruhten wie bei meiner<br />
Mutter und der jede Veränderung so resolut ablehnte wie sie. Sie duldete die Gegenwart, beurteilte sie<br />
jedoch stets vom Standpunkt ihrer eigenen Vergangenheit, so unmaßgeblich diese auch sein mochte.<br />
Bis in meine späteren Teenagerjahre beruhten meine Vorstellungen vom Zweiten Weltkrieg fast<br />
ausschließlich auf illustrierten Büchern über die Abenteuer heroischer alliierter Soldaten, die in der<br />
Schule als „Schundliteratur“ galten (unter dem Eindruck dieser Schriften war ich ein eifriger Kritzler<br />
von Schlachtschiffen und Flugzeugen).<br />
Wenn ich zuhören musste, wie meine Mutter vom „Blitz“ (d. h. den deutschen Luftangriffen auf<br />
London) erzählte, hörte ich manchmal nur mit halbem Ohr hin oder vergaß diese unermüdlich<br />
wiederholten Anekdoten sogar absichtlich, weil ich einen gewissen Widerwillen gegen sie empfand.<br />
Heute bedaure ich dies, denn auch ein subjektiv gefärbter Erlebnisbericht über das Leben im London<br />
der Kriegszeit wäre sehr informativ gewesen. Doch die Art und Weise, wie meine Mutter ihre<br />
Monologe hielt, ließ wenig Raum für Fragen, hätte sie solche doch nur als unerwünschte<br />
Unterbrechungen ihrer vorprogrammierten „Rundfunksendung“ betrachtet.<br />
Bei den seltenen Besuchen, die meine Eltern meiner deutschen Schule im Jahre 1957 abstatteten,<br />
brachte meine Mutter wiederholt das „Wirtschaftswunder“ zur Sprache, den raschen Wiederaufbau der<br />
deutschen Städte und der deutschen Industrie nach dem Krieg. Ich war damals neun Jahre alt, und<br />
dieses Phänomen war mir ebenso wenig bewusst wie die Absurdität der Tatsache, dass zwei<br />
hochentwickelte angelsächsische Nationen einander bis aufs Messer bekämpft hatten. Ungefähr<br />
fünfzehn Jahre später hörte ich einen hitzköpfigen amerikanischen Oberst am Radio folgendes<br />
zutreffende Urteil fällen: „Dass sich Briten und Deutschland auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden,<br />
war völlig unlogisch.“ Sämtliche Deutschen, die ich kannte, waren ungemein liebenswert und fielen<br />
höchstens dadurch auf, dass sie anscheinend alle dasselbe Modell eines glänzenden dunkelblauen<br />
Anzugs besaßen – vielleicht ein Hinweis darauf, wie sehr sie sich nach einer Rückkehr zu geordneten<br />
bürgerlichen Verhältnissen sehnten. Die Schülerinnen und Schüler in Hermannsberg waren ebenfalls<br />
Paradebeispiele für Normalität: In ihrer Freizeit beschäftigten sie sich mit Spiel und Sport, vergnügten<br />
sich, hörten Musik und gaben sich allerlei Aktivitäten im Freien hin. Dass ihre und meine Vorfahren<br />
dazu angestachelt worden waren, sich gegenseitig an die Gurgel zu fahren, wurde mir gar nicht erst<br />
bewusst. Der einzige Hinweis auf den Krieg, an den ich mich erinnere, war ein Wortwechsel zwischen<br />
zwei älteren Knaben, den ich mitbekam, während ich mich nach der morgendlichen Dusche<br />
abtrocknete: Sie erzählten, was sie über das Schicksal deutscher Kriegsgefangener in Russland gehört