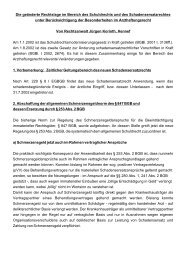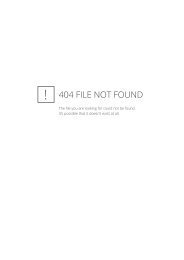Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit
Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit
Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kausalitätsbeurteilung 247 120<br />
der nicht-insulinabhängige Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes; früher:<br />
Altersdiabetes)<br />
a) bei nicht Übergewichtigen<br />
b) bei Übergewichtigen<br />
der Diabetes mellitus verbunden mit bestimmten Syndromen und<br />
sekundär bedingt, z.B. bei Pankreaserkrankungen, Endokrinopathien<br />
und genetischen Syndromen sowie durch Arzneimittel, Chemikalien<br />
und Abnormitäten des Insulins und seiner Rezeptoren<br />
der Schwangerschaftsdiabetes.<br />
Beim insulinabhängigen Diabetes mellitus ist von einer genetischen Disposition<br />
auszugehen. Diese ist jedoch von geringer Penetranz. Die Ätiologie <strong>die</strong>ser Diabetesform<br />
ist nicht geklärt. Es wird aber diskutiert, dass bei entsprechender genetischer<br />
Disposition Umwelteinflüsse, wie z.B. Infekte (vor allem mit pankreotropen<br />
Viren), toxische Substanzen sowie bestimmte Ernährungsfaktoren, und evtl. auch<br />
körpereigene Stressproteine einen Autoimmunprozess auslösen, der im Laufe<br />
von etwa einem halben Jahr bis zu mehreren Jahren – bei Kindern auch in etwas<br />
kürzeren Fristen – zur Entwicklung eines insulinabhängigen Diabetes mellitus<br />
führen kann. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Manifestation des insulinabhängigen<br />
Diabetes mellitus und einem der genannten exogenen Schädigungsfaktoren<br />
ist nicht mit Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, es sei denn, dass<br />
Brückensymptome (Immunmarker der Insulitis) zu einem relevanten Infekt nachgewiesen<br />
sind. Anderenfalls kommt eine Kannversorgung in Betracht.<br />
Der nicht-insulinabhängige Diabetes mellitus (dazu gehört auch ein Diabetes<br />
mellitus, der wegen Versagens der oralen Antidiabetika-Therapie mit Insulin behandelt<br />
werden muss) ist vermutlich eine heterogene Erkrankung. Pathogenetisch<br />
ist nicht eindeutig geklärt, ob <strong>die</strong> epidemiologisch nachweisbare genetische<br />
Disposition primär zu einer Störung des Glukosestoffwechsels infolge einer<br />
Insulinresistenz und/oder einer Sekretionsstörung des Insulins führt. Beim nichtinsulinabhängigen<br />
Diabetes mellitus ist <strong>die</strong> Penetranz der Erbanlage stärker als<br />
beim insulinabhängigen Diabetes mellitus. Das Hinzutreten von Faktoren, <strong>die</strong><br />
eine Insulinresistenz begünstigen, vor allem Fettsucht, Bewegungsmangel, Hypertriglyzeridämie,<br />
bestimmte Medikamente, endokrinologische und andere<br />
Erkrankungen wie Leberzirrhose und Infekte sind in der Regel ausschlaggebend<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Manifestation <strong>die</strong>ses Diabetestyps. Dabei wird angenommen, dass der<br />
Manifestation des nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus eine Lebensphase<br />
mit gestörter Glukosetoleranz vorausgeht. Eine Anerkennung als Schädigungsfolge<br />
(dann im Sinne der Verschlimmerung) kommt nur selten in Betracht.<br />
Sekundär kann sich ein Diabetes mellitus aufgrund einer weitgehenden Zerstörung<br />
des Inselzellgewebes der Bauchspeicheldrüse (z.B. durch Trauma, Entzün-