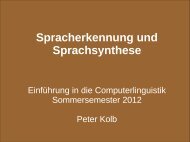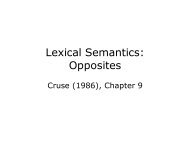Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 6: Zusammenfassung<br />
was an<strong>der</strong>e Unterfangen dieser Art wie das von Ritchie et al. (1992) o<strong>der</strong> Antworth (1994)<br />
erzielten.<br />
6.2 Typisierte Merkmalsstrukturen<br />
Was bringen Grammatiken auf <strong>der</strong> Grundlage typisierter Merkmalsstrukturen? Sicherlich<br />
erzwingen sie bei ihrer Konstruktion größere Genauigkeit und mehr Reflexion über die Ontologie<br />
<strong>des</strong> Gegenstandsbereiches. Ob <strong>der</strong> von einigen Autoren wie Carpenter (1992) behauptete<br />
Effizienzgewinn <strong>der</strong> typisierten Unifikation gegenüber ihrem untypisierten Pendant<br />
tatsächlich eintritt – schließlich muß eine aufwendige Unifikationsoperation nicht<br />
durchgeführt werden, wenn schon die Ausgangstypen nicht kompatibel sind – darf in<strong>des</strong>sen,<br />
vor allem bei überwiegend disjunktiv definierten Hierarchien bezweifelt werden. Meist<br />
werden hierbei Kategorien unifiziert, die entwe<strong>der</strong> vom gleichen Typ sind o<strong>der</strong> in einer Super–Subtyp-Beziehung<br />
zueinan<strong>der</strong> stehen.<br />
Weitere Probleme von typisierten Formalismen im präsentierten Kontext sind:<br />
• Wie im letzten Kapitel schon einmal kurz angedeutet, gibt es einen Zielkonflikt zwischen<br />
Unterspezifikation einerseits und <strong>der</strong> Notwendigkeit, Typen voneinan<strong>der</strong> unterscheidbar<br />
zu machen an<strong>der</strong>erseits. Ein maximal unterscheidbares Typensystem benutzt keine<br />
Hierarchisierung in Subtypen; die einzelnen Typen sind durch Unifikation auseinan<strong>der</strong>zuhalten.<br />
Dafür ist keine Unterspezifikation über Typen hinweg möglich. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite stehen Typsysteme mit ausgeprägter hierarchischer Ordnung, in denen Sub-<br />
und Supertypen durch Unifikation nicht voneinan<strong>der</strong> zu trennen sind. Dies gelingt nur<br />
durch eine nicht-monotone Subsumptionsoperation, die aber <strong>der</strong> Monotonie als einer<br />
wünschenswerten Eigenschaft eines logischen Systems zuwi<strong>der</strong>läuft, wie folgen<strong>des</strong> Beispiel<br />
noch einmal verdeutlicht:<br />
t ↔ a | b<br />
s1 ← X ∧ t ∧ (X v b) ∧ X ∧ a<br />
s2 ← X ∧ a ∧ (X v b) ∧ X ∧ t<br />
Die Sorten s1 und s2 sind nicht äquivalent.<br />
• Wie ebenfalls im letzten Kapitel deutlich wurde, sind Merkmalsstrukturen nicht geeignet,<br />
Wissensrepräsentationsformalismen zu ersetzen, obwohl sie ja mit diesen eng verwandt<br />
sind. Möchte man sich, wie bei den Kompositadeutung mittels einer konzeptuellen<br />
Relation in <strong>der</strong> Typenhierarchie von den spezifischeren Typen zu ihren Supertypen<br />
bewegen, so erreicht man dies allenfalls durch eine geschickte Anordnung <strong>der</strong> Sorten im<br />
Programmtext, nicht aber auf prinzipielle Weise. Auch sind hierbei keine Inferenzen<br />
möglich. Hilfreich wäre bei <strong>der</strong> gewählten Logik gewesen, wenn sie über rekursive Typenconstraints<br />
verfügen würde, wie sie in Systemen wie ALE (Carpenter/Penn (1994))<br />
und TROLL (Gerdemann et al. (1995)) integriert sind. Mit diesem Hilfsmittel wäre es<br />
möglich, einen guten Teil <strong>der</strong> notwendigen Wissensrepräsentation in die Typenconstraints<br />
zu verlagern. Letztlich aber wird man bei einem realistischen Weltwissensfragment<br />
nicht umhin können, auf einen <strong>der</strong> üblichen frame-basierten Wissensrepräsentationsformalismen<br />
auszuweichen, mit dem auch prozedurales Wissen abgebildet werden<br />
kann (vgl. Reimer (1991)).<br />
• Zum Schluß: Unifikation scheitert o<strong>der</strong> sie scheitert nicht. Es gibt keine „Zwischenwerte“,<br />
mit denen die graduelle Akzeptabilität einer <strong>Analyse</strong> ausgedrückt werden<br />
177