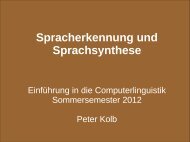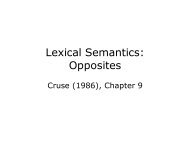Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 3: Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
True Complement Coercion beschreibt hingegen den Sachverhalt, daß zur Interpretation nicht<br />
die Elemente <strong>der</strong> Argumentstruktur, son<strong>der</strong>n Argumente von Relationen, die innerhalb <strong>der</strong><br />
Qualiastruktur eines Wortes o<strong>der</strong> Wortbestandteiles, herangezogen werden. Beispiele aus<br />
dem phrasalen Bereich und <strong>der</strong> Wortbildung sind:<br />
(77)<br />
a) Theo hat das Buch gerade erst angefangen<br />
b) Nagelfabrik<br />
In beiden Fällen wird eine Argumentstelle <strong>der</strong> telischen Relation benutzt (bei a) lesen, bei b)<br />
herstellen), die an das Objekt bzw. das Worterstglied gebunden wird.<br />
Dies sollte nun fürs Erste genügen, um eine Vorstellung von den Interpretationsmechanismen,<br />
die innerhalb <strong>der</strong> Wortbildung wirksam sind, zu erhalten. Eine modifizierte, erweiterte<br />
und an die Wortbildung angepaßte Variante <strong>der</strong> Konzeption von Pustejovsky ist schließlich<br />
Gegenstand von Kapitel 5.<br />
3.5 Resümee<br />
3.5.1 Vereinheitlichung von Komposition und Derivation?<br />
Die augenscheinlichen Parallelen zwischen Eigenschaften <strong>der</strong> Komposition einerseits und<br />
Derivation an<strong>der</strong>erseits – zu nennen sind hier nur Binarität und Rechtsköpfigkeit komplexer<br />
Strukturen – haben einige Autoren (wie z.B. Höhle (1982)) zu <strong>der</strong> Annahme geführt, daß<br />
beiden <strong>der</strong> gleiche Mechanismus zugrundeliegt und sie sich lediglich im beteiligten Material<br />
unterscheiden, genauer, hinsichtlich <strong>des</strong> Werts für ein Merkmal gebunden. Höhle (1982) führt<br />
als Argumente für diesen Standpunkt – auch Kompositionstheorie <strong>der</strong> Affigierung genannt<br />
– eine Reihe von Argumenten an (vgl. Höhle (1982:88ff.)):<br />
a) Bei Komposita wie bei Derivaten flektieren nur die Zweitglie<strong>der</strong>.<br />
b) Fugenelemente können bei beiden Wortbildungstypen zwischen die Glie<strong>der</strong> treten, vgl.<br />
Haltungsschäden vs. haltungslos.<br />
c) Die Daten zur Tilgung unter Koordination entsprechen sich, vgl. Herrenmäntel und<br />
-schuhe, erkenn- und begreifbar.<br />
d) Die Zulässigkeit von Argumentvererbung scheint bei beiden Typen weniger an <strong>der</strong> Unterscheidung<br />
Komposition – Derivation zu hängen als an Eigenschaften <strong>der</strong> beteiligten<br />
Morpheme.<br />
M.E. gibt es jedoch einige gewichtige Gegenargumente. Man muß zwar konzedieren, daß,<br />
wenn man sich auf die formalen Eigenschaften <strong>der</strong> beiden Wortbildungstypen beschränkt,<br />
Höhles Argumentation sehr plausibel erscheint. An<strong>der</strong>erseits sind seine Argumente ausschließlich<br />
morphologischer Natur, was, wie ich meine, <strong>der</strong> Sache nicht gerecht wird. Die<br />
These, die ich in dieser Arbeit vertrete (und die natürlich nicht neu ist) ist die, daß das Interessante<br />
an Wörtern nicht ihre Syntax ist, son<strong>der</strong>n ihre Interpretation. Diese ist, wie in Kapitel<br />
5 noch ausführlich diskutiert werden wird, bei den beiden betrachteten Wortbildungsoperationen<br />
jedoch grundverschieden. Derivation und Rektionskomposition zeigen noch eine<br />
weitgehende Kopplung von Formations- und Interpretationsregeln, was bei <strong>der</strong> allgemeinen<br />
Komposition nicht mehr <strong>der</strong> Fall ist.<br />
Man könnte nun versucht sein, zur Grenzziehung zwischen Komposition und Derivation<br />
nicht morphologische Merkmale wie �GEBUNDEN, son<strong>der</strong>n die semantische Interpretation<br />
dieser Konstruktionstypen heranzuziehen. Affixe hätten dieser Idee zur Folge keine eigene<br />
Semantik und ihr Beitrag bei <strong>der</strong> Wortbildung sei ein rein funktionaler. Frei vorkommende<br />
88