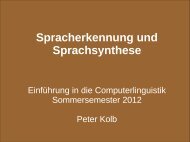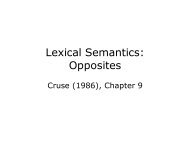Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(22)<br />
a) die Soldaten beobachten die Grenze<br />
b) die Beobachtung <strong>der</strong> Grenze<br />
c) *<strong>der</strong> Beobachtungsturm <strong>der</strong> Grenze<br />
Kapitel 3: Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
Das Nomen Beobachtungsturm in <strong>der</strong> Nominalphrase in (22c) mit <strong>der</strong> Interpretation „Turm,<br />
von dem aus die Grenze beobachtet wird“, nicht in <strong>der</strong> Possessiv-Lesart, ist wie erwartet strukturiert:<br />
(23) [N [N [V Beobacht] [N ung(s)]] [N turm]]<br />
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist <strong>der</strong> Kontrast in (22) darauf zurückzuführen, daß sich gebundene<br />
und freie Instanzen von Kategorien wie N nicht nur hinsichtlich eines Merkmals<br />
±gebunden unterscheiden, son<strong>der</strong>n darüber hinaus in ihrem semantischen Beitrag zum Gesamtwort.<br />
Während gebundene Kategorien (Suffixe) wie -ung nur die Bedeutung <strong>der</strong> ihnen<br />
vorangehenden Konstituente transformieren, machen freie Kategorien einen eigenständigen<br />
Beitrag zum Gesamtwort. Beispielsweise wird im Determinativkompositum Beobachtungsturm<br />
das Nomen Turm durch das Erstglied näher bestimmt. Die Nicht-Akzeptabilität von<br />
(22c) ist daher wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß<br />
(24) ??* <strong>der</strong> Turm <strong>der</strong> Grenze<br />
bereits nicht akzeptabel ist.<br />
Neben diesen Beschränkungen semantischer Natur gibt es weitere, die dem Anschein nach<br />
wie<strong>der</strong> syntaktisch zu erklären sind. Es gibt einen interessanten Kontrast zwischen den ung-<br />
Nominalisierungen von Verben mit Akkusativobjekt und solchen mit Dativobjekt.<br />
(25)<br />
a) Die Touristen vertreiben das Wild<br />
b) Die Vertreibung <strong>des</strong> Wilds<br />
(26)<br />
a) das Geräusch <strong>der</strong> Rasenmäher belästigt den Linguisten<br />
b) die Belästigung <strong>des</strong> Linguisten<br />
Die meisten <strong>der</strong> Verben mit Akkusativobjekt, die unter dem entsprechenden Satzbauplan im<br />
Duden (1984:607) verzeichnet sind, lassen eine Ableitung mit -ung zu. Dabei wird immer die<br />
Thetarolle, die das Akkusativobjekt trägt, an das Derivat vererbt. Demgegenüber ist ung-<br />
Derivation bei den Verben mit Dativobjekt fast nie möglich, vgl.<br />
(27)<br />
a) <strong>der</strong> Soldat gehorcht dem Befehl<br />
b) * die Gehorchung <strong>des</strong> Befehls<br />
Einige Verben mit Dativobjekt bilden ihre Nominalisierung durch Ableitung mit -e (vgl.<br />
Toman (1987:60)):<br />
(28)<br />
a) <strong>der</strong> Sohn hilft dem Vater<br />
b) die Hilfe <strong>des</strong> Vaters<br />
Ein Verb mit ähnlicher Semantik wie helfen, unterstützen, realisiert die Thetarolle Benefizient<br />
als Akkusativobjekt.<br />
(29)<br />
a) <strong>der</strong> Sohn unterstützt den Vater<br />
b) die Unterstützung <strong>des</strong> Vaters<br />
60