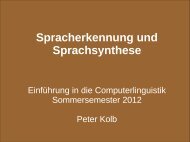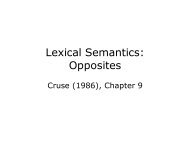Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 3: Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
neten Argumentliste zu sättigende Argumentstellen festhalten. Auf diese Weise ist es<br />
möglich, semantische Kombinationsbeschränkungen wie<strong>der</strong> auf syntaktische zurückzuführen.<br />
Anschließend kann das etwas ineffiziente generate-and-test-Verfahren <strong>des</strong> Ansatzes<br />
verbessert werden, indem Beschränkungen <strong>der</strong> Testphase in den Generator vorverlegt<br />
werden und somit so früh wie möglich zur Anwendung kommen.<br />
3. Wie wir weiter oben gesehen haben, kann sinnvollerweise zwischen stereotypen Relationen<br />
– diejenigen, die mit dem �-Operator in <strong>der</strong> Konzeption von Meyer (1993) verknüpft<br />
sind –, und Relationen, die eher konzeptuellen Ursprungs sind, unterschieden werden.<br />
Diese Unterscheidung findet keinen Reflex in Fanselows Ansatz, trivialerweise <strong>des</strong>halb,<br />
da er – obgleich semantisch-konzeptuell orientiert – nur stereotype Relationen kennt. Eine<br />
Erweiterung um konzeptuelle Relationen scheint jedoch kein Problem darzustellen.<br />
4. Wenn man Fanselow (1987, 1988b) folgt, dann ist die Interpretation von Wort- wie von<br />
Phrasenstrukturen nicht eng an diese gebunden, son<strong>der</strong>n Teil <strong>des</strong> konzeptuellen Systems.<br />
Es gibt demnach nur eine solche Komponente, die in beiden Fällen nach exakt den gleichen<br />
Prinzipien arbeitet. Wie ist es aber dann zu erklären, daß diese Komponente sensitiv<br />
gegenüber <strong>der</strong> Unterscheidung wortintern – wortextern ist, die sich beispielsweise bei <strong>der</strong><br />
Argumentvererbung bemerkbar macht: „[...] we are forced to conclude that obligatory<br />
arguments of verbs must be filled within the complex word itself [...]“ (Fanselow<br />
(1988b:40)).<br />
5. Fanselows Leugnung <strong>der</strong> Möglichkeit von Argumentvererbung ist bereits kritisiert worden,<br />
so u.a. von Reis (1983); diese Argumente sollen hier nicht wie<strong>der</strong>holt werden. Einen<br />
weiteren Einwand gegen Fanselow möchte ich jedoch noch hinzufügen; dieser ergibt<br />
sich, wenn man die in Abschnitt 3.2.2.2 dargestellte be-Präfigierung für einen produktiven<br />
und damit regelgeleiteten Prozeß hält. Das dort genannte Beispiel sei hier noch einmal<br />
wie<strong>der</strong>holt:<br />
(65)<br />
a) Sie gießt [NP Wasser] [PP auf die Blumen ]<br />
b) Sie begießt [NP die Blumen] [PP mit Wasser ]<br />
Bei <strong>der</strong> be-Präfigierung von dreiwertigen Verben kommt es zu einer charakteristischen<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> syntaktischen Realisierung <strong>der</strong> Objektsthetarollen. Fanselow schließt nun –<br />
wie oben dargestellt – Funktionalkomposition und damit Argumentvererbung aus dem<br />
Repertoire <strong>der</strong> für die Derivation zur Verfügung stehenden Operationen aus. Er bezieht<br />
sich zwar nur auf die Suffigierung, aber ich sehe nicht, warum seine Argumente nicht<br />
auch für die Präfigierung gelten sollten. Die m.E. systematische Beziehung zwischen be-<br />
und Simplexverb wird danach so hergestellt, daß aus dem be-Verb eine stereotype Relation<br />
erschlossen wird, die eben Argumente von einer bestimmten Art erfor<strong>der</strong>t. Diese<br />
Relation kann in Beispiel (65b) jedoch nur gießen sein, nicht jedoch begießen, da das Verb,<br />
welches letztere ausdrückt, ja erst gebildet wird. Ist gießen jedoch die aus begießen erschlossene<br />
Relation, so bleibt ungeklärt, warum <strong>des</strong>sen Argumente in einer an<strong>der</strong>en Reihenfolge<br />
und syntaktisch in unterschiedlicher Weise verwirklicht werden. Die Argumentreihenfolge<br />
<strong>des</strong> Simplexverbs übertragen auf das be-Verb würde schließlich so aussehen:<br />
(66) * Sie begießt [PP mit Wasser ] [NP die Blumen]<br />
was jedoch nicht akzeptabel ist. Der Schluß, den ich daraus ziehe ist <strong>der</strong>, daß man das<br />
Phänomen <strong>der</strong> Argumentvererbung nicht gänzlich leugnen kann und daher im formalen<br />
semantischen Apparat auch eine Operation – Funktionalkomposition – benötigt, die dieses<br />
Phänomen rekonstruiert.<br />
81